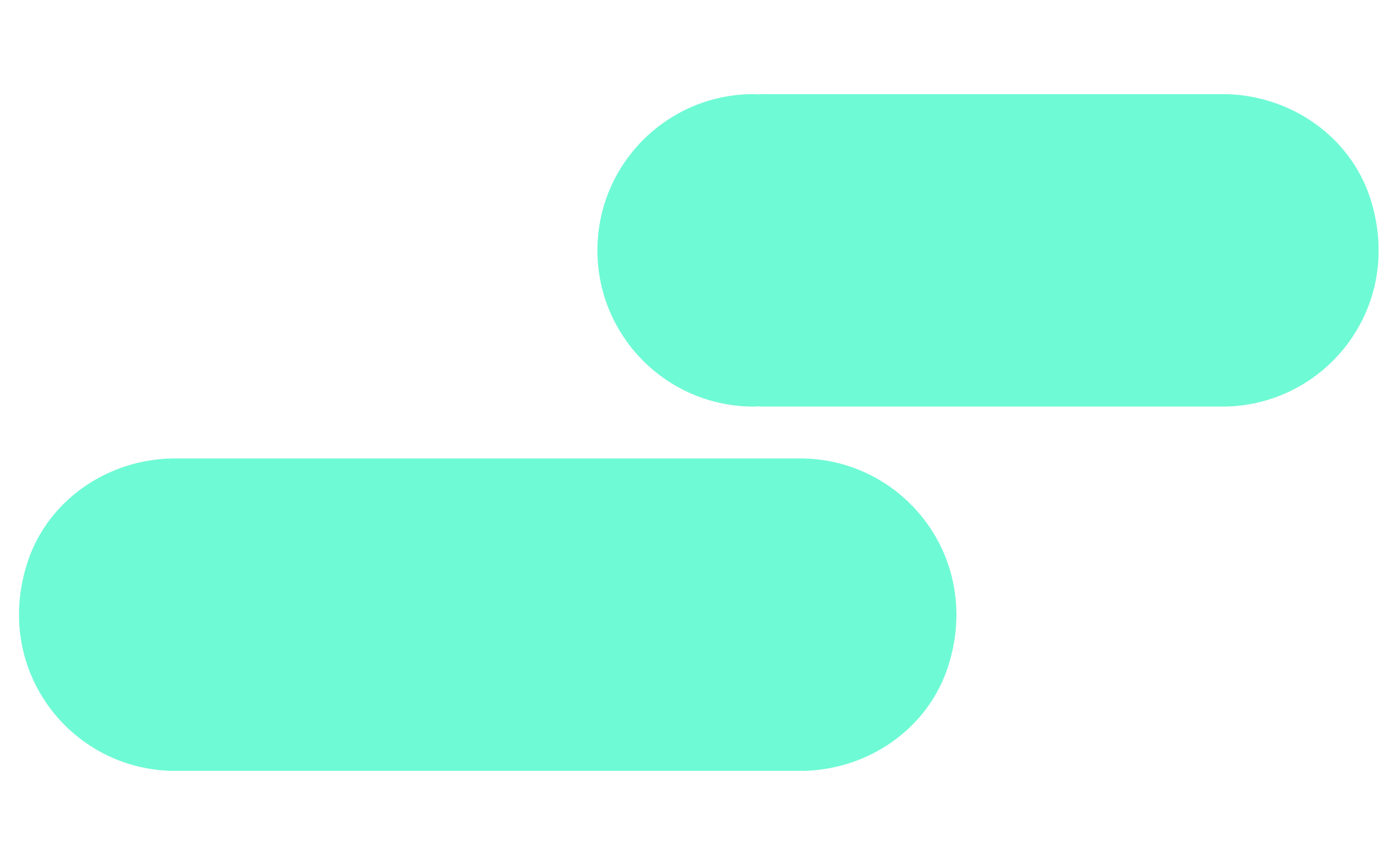Von Jonas J. Schmid – Die identität sehr wichtiger Instrumente der direkten Demokratie wären durch Einschränkungen auf allen Niveaus betroffen. Auf Bundesebene wären sehr geringe Einbussen zu erwarten, auf der kantonalen- und Gemeinde-Ebene wären sie signifikanter.
Mit diesem Beitrag wird eine fünfteilige Blog-Reihe zum Verhältniss zwischen der Schweiz und der EU fortgesetzt. Die Reihe versucht, den Ist-Zustand sowie Chancen und Risiken von künftigen Entwicklungen aufzeigen und zu gewichten. Während fünf Wochen wird hier jeden Donnerstag ein neuer Beitrag dazu erscheinen.
Ein Integrieren der Schweiz in die Gemeinschaft der 28 Staaten würde nicht ohne Reibungen vonstatten gehen, so viel ist klar. Mit Sicherheit würde die Frage der Souveränitätsabtretung und dem partiellen Umkrempeln des „Schweizer Sonderfalls“ in vielen verschiedenen politischen Aspekten intensiv und von Grund auf diskutiert. So müssten auch die in der Bevölkerung stark verankerten Instrumente der direkten Demokratie überarbeitet werden. Man sollte jedoch unterscheiden zwischen einmaligen Anpassungen bei der Übernahme des Rechtsbestandes (des acquis communautaire) und Einschränkungen auf die politische Praxis, welche dieser neue Rahmen vorgeben würde.
Bei einer Mitgliedschaft in der EU, also einer Übernahme des Rechts, würde sich die Schweiz nicht nur verpflichten, europäische Verordnungen einzuhalten, sondern auch entgegenstehendes nationales Recht zu eliminieren. Es ist jedoch klar, dass die Anpassung an EU-Recht sich in der Praxis nicht durch direktdemokratische Elemente zu Fall bringen liesse. Professor Thomas Cottier (Universität Bern) schätzt, dass etwa die Hälfte der Bundesgesetze teils geringfügig angepasst werden müsste. Zudem könnte eine in der EU abgesegnete Verordnung, nach der Übernahme des Rechtsbestandes, nicht mehr durch direktdemokratische Elemente in Frage gestellt werden, da Verordnungen direkt ihre Wirkung entfalten, ohne in den nationalen Rechtsbestand aufgenommen werden zu müssen.
Das Problem zeigt sich auch bei Richtlinien des übernommenen Rechtsbestandes, welche auf nationaler Ebene umgesetzt werden müssten und bei denen die Bevölkerung den nationalstaatlichen Implementierungsprozess nur beschränkt beeinflussen könnte, nämlich nur im vorgegebenen Spielraum der Richtlinien. Verfassungsrechtsexperten sind sich jedoch einig, dass in der Praxis das Referendum für umsetzende Gesetzgebung ausgeschlossen werden müsste.
Die eingeschränkte Tragweite des Referendums auf nationalstaatlicher Ebene wäre vor allem darum von Wichtigkeit, als die Vernehmlassungsprozedur, welche das Verhindern eines Referendums durch Einbindung von diversen Positionen zum Ziel hat, die integrativen und konsens-orientierten Kräfte schwächen würde. Dieses Prozedere hat massgeblich die Konkordanz in der Schweizer Politik-Kultur geformt.
Was die Initiative auf Bundesebene betrifft, so wären in Zukunft nur Initiativen möglich, welche – neben den üblichen Anforderungen – dem EU-Recht nicht widersprechen, es würde also zu einer Abnahme von Möglichkeiten kommen, Einfluss auf die Verfassung zu nehmen.
Generell gilt, solange die darüber abzustimmende Vorlage nicht in den Kompetenzbereich der EU fällt, unterläge der Bund keinerlei Einschränkungen, ausser dem bereits heute geltenden Völkerrecht. Sowieso wird seit mehreren Jahren die Europakompatibilität jedes Bundesgesetzes durch die entsprechende Botschaft des Bundesrates geprüft. Als Folge gibt es schon heute kaum mehr grosses Konfliktpotential: Das Europa-Institut Zürich hat die 46 dem obligatorischen und die 278 dem fakultativen Referendum unterstellten Vorlagen im Zeitraum vom 1. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1998 untersucht. Bloss ein geringer Teil der nationalen Vorlagen, welche in den Kompetenzbereich der EU fallen würden, enthielt ein gewisses Konfliktpotenzial mit dem Unionsrecht, genauer gesagt 11% der Vorlagen, welche dem obligatorischen bzw. 14% der Vorlagen, welche dem fakultativen Referendum unterstellt waren (Bundesratsbericht 1999). Dies bedeutet, dass bei 85% bis 90% der nationalen Vorlagen nach wie vor der Schweizer Bevölkerung ein Letztentscheidungsrecht zugestanden würde.
Doch sollte man nicht allzu voreilig sein, denn dieses „positive“ Bild auf nationaler Ebene kann täuschen: Schaut man eine Ebene tiefer auf die Kantone, so sieht es anders aus. Der Geltungsbereich des kantonalen Referendums und der kantonalen Initiative wäre substantiell verkleinert, da EU-Kompetenzen zu einem grösseren Teil kantonalen Kompetenzen entsprechen als nationalen. Trotzdem stellt sich jedoch die dringende Frage, ob die Nichtmitsprache der Kantone (und des Bundes) in europäischen Angelegenheiten nicht wohl den grösseren Verlust an Selbstbestimmung darstellt.
Jonas Schmid macht einen Master in Vergleichender Internationaler Politik an der ETH Zürich und lebt in Bern. Er dankt Maj-Britt Horlacher, Elisa Ravasi und Patrice Zumsteg für das zur Verfügung stellen eines nicht veröffentlichten Papers zum Thema.
Der foraus-Blog ist ein Forum, das sowohl den foraus-Mitgliedern als auch Gastautoren/innen zur Verfügung gestellt wird. Die hier veröffentlichten Beiträge sind persönliche Stellungnahmen der Autoren/innen Sie entsprechen nicht zwingend der Meinung der Redaktion oder des Vereins foraus.