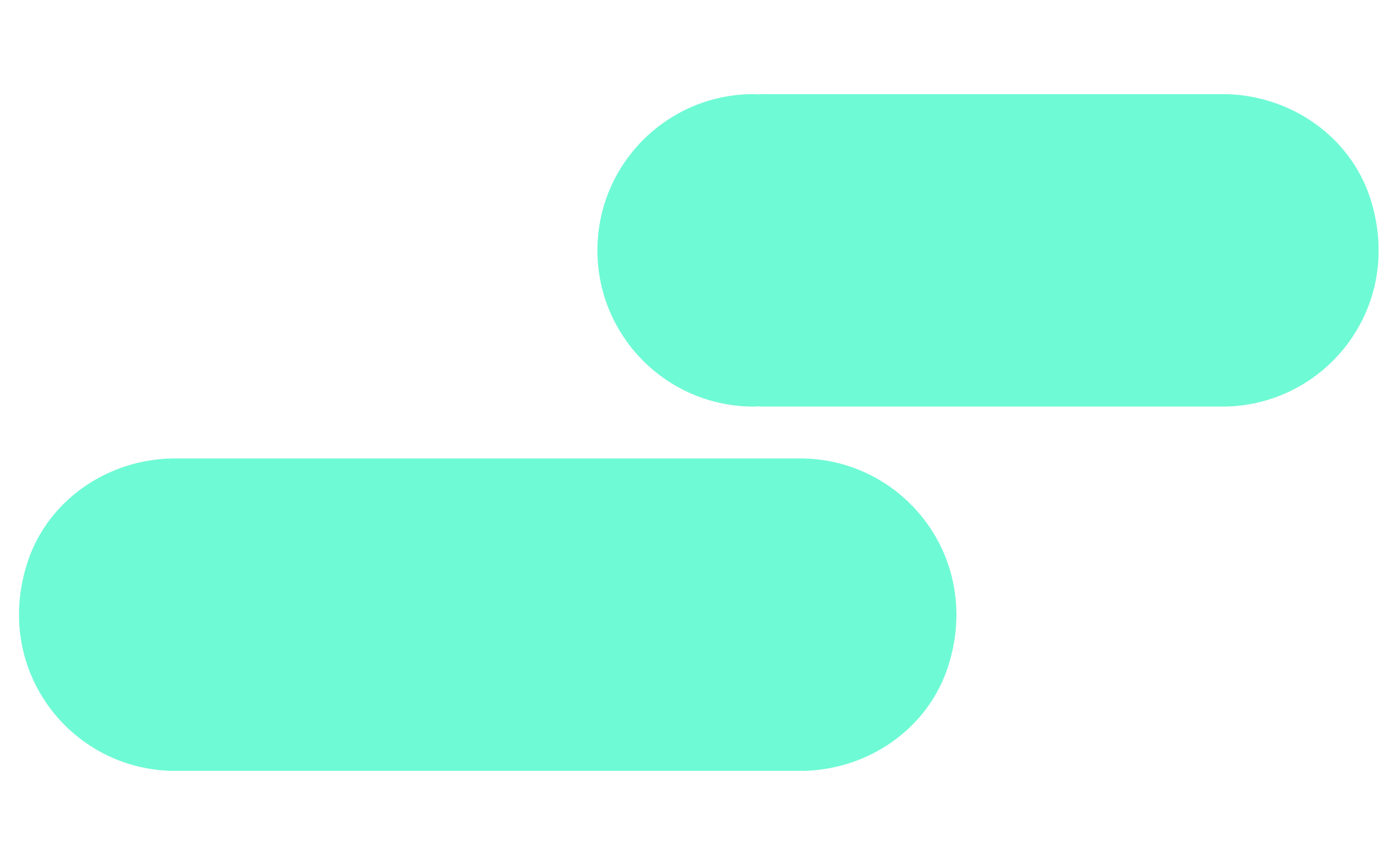Die Frustration afrikanischer Staaten über die Vorgehensweise des Internationalen Strafgerichtshofs hat mit der Strafverfolgung des kenianischen Präsidenten und Vizepräsidenten ihren Höhepunkt erreicht. Vorschläge sind da. In dieser Situation kommt der Schweiz eine zentrale vermittelnde Rolle zu.
Morgen beginnt die Versammlung der Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag. Dabei wird die Suche nach einem Ausweg aus der momentanen Krise eines der zentralen Themen sein: Im März wurden Uhuru Kenyatta und William Ruto zum Präsidenten beziehungsweise Vizepräsidenten Kenias gewählt. Beide Personen wurden bereits zuvor vom ICC wegen der angeblichen Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit den Gewaltausbrüchen nach den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2007 angeklagt. Seit Kenyatta und Ruto nun an der Spitze Kenias stehen, bläst dem Internationalen Strafgerichtshof seitens der afrikanischen Staaten, welche die grösste Gruppe der Vertragsstaaten bilden, ein eisiger Wind entgegen.
Neben der Bestrebung, sich vom ICC mittels Vertragsrücktritt loszusagen, konnte Kenia einen Grossteil der afrikanischen Staaten hinter sich scharen, um gegen den Strafgerichtshof Stimmung zu machen. Die Frustration dieser Staaten gründet im Umstand, dass der ICC bisher nur Fälle in Afrika untersucht und hochrangige afrikanische Staatsrepräsentanten verfolgt hatte. Sie bemängeln die Selektivität der Strafverfolgung und die Doppelmoral der westlichen Staaten, deren Verbrechen vom Gerichtshof bisher nicht beleuchtet wurden. Ihren bisherigen Höhepunkt fand die Kritik in einer in Addis Abeba verabschiedeten Entscheidung der Afrikanischen Union: Die Verfahren gegen Kenyatta und Ruto sollten suspendiert werden. Diesbezüglich brachten Ruanda, Togo und Marokko kürzlich einen Resolutionsentwurf beim UNO Sicherheitsrat ein, wonach dieses Gremium gemäss Artikel 16 des Gründungsdokuments des ICC – dem Römer Statut – die Aufschiebung der Strafverfahren gegen die beiden kenianischen Amtsträger um 12 Monate entscheiden soll. Obwohl dieser Vorstoss nicht die nötige Unterstützung im Sicherheitsrat fand (sieben Mitglieder inkl. Russland und China votierten aber für den Entwurf), kommt das Missbehagen der afrikanischen Staaten gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshofs deutlich zum Ausdruck.
Zwischen Verständnis und Doppelmoral
Die Stimmungsmache Kenias gegen den ICC ist zu einem gewissen Grad selbst von einer Doppelmoral geprägt. Kenia ist seit 2005 Vertragsstaat des Gerichtshofs und hat sich somit freiwillig der Gerichtsbarkeit des ICC unterworfen, welcher die schwersten Völkerrechtsverbrechen – Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und künftig auch das Verbrechen der Aggression – verfolgt. Darüber hinaus ist der ICC eine ultima ratio: Er operiert auf der Grundlage des Komplemenaritätprinzips, wonach er sich erst dann eines Falles annehmen kann, wenn der betreffende Staat nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen. Kenia hätte es demnach selbst in den Händen gehabt, die Vorwürfe in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen von 2007 zu untersuchen und entsprechende nationale Strafverfahren einzuleiten. Weil dies nicht geschehen ist, befasst sich nun der ICC mit den beiden Fällen betreffend Kenyatta und Ruto.
Abgesehen von unbegründeten Angriffen gegen den Internationalen Strafgerichtshof sind die Anliegen der afrikanischen Staaten zu einem gewissen Grad aber auch legitim. Anlässlich der letzten Berichterstattung des ICC vor der Generalversammlung der UNO Ende Oktober in New York zeigten sich viele Delegationen offen für einen konstruktiven Dialog mit den afrikanischen Ländern. Ob jedoch die Legitimität der Anliegen alleine diesen Umschwung in der Staatengemeinschaft bewirkt haben ist fraglich, denn die Argumente betreffend Selektivität und Doppelmoral wurden schon seit längerer Zeit, insbesondere seit der Anklage des sudanesischen Präsidenten, Omar al Bashir, vorgebracht. Die Reaktion der Staatengemeinschaft lässt sich wohl vielmehr dadurch erklären, dass die afrikanischen Staaten mit ihren Demarchen erfolgreich Druck aufgesetzt haben. Ein Entgegenkommen ist angezeigt, um zu vermeiden, dass Staaten vom Römer Statut zurücktreten, was für den ICC als noch relativ junge Institution ein herber Rückschlag darstellen würde.
Die Hauptverfahren werden verschoben
Erst vor wenigen Tagen hat der ICC nun entschieden, das Hauptverfahren gegen den kenianischen Präsidenten erst anfangs Februar 2014 zu beginnen. Das gibt der Staatengemeinschaft wichtige Zeit, um einen Ausweg zu finden. In dieser Phase sind insbesondere die Vertragsstaaten gefordert, welche den Gerichtshof unterstützen. Wie aus ihren Stellungnahmen hervorgeht, soll eine Lösung im Rahmen des Römer Statuts gefunden werden. Der Fokus liegt auf einem konstruktiven Dialog mit den afrikanischen Staaten. Die bisher gemachten Vorschläge zur Entschärfung der Situation sind vor allem praktischer und technischer Natur. So betonte Tiina Intelmann, die Präsidentin der Versammlung der Vertragsstaaten, im Rahmen des Völkerrechtswochenendes in New York: Es solle darauf geachtet werden, dass sich die beiden höchstrangigen Staatsrepräsentanten Kenias nie gleichzeitig in Den Haag vor dem ICC zu verteidigen haben. Dieser Vorstoss steht im Einklang mit dem Wortlaut von Artikel 63 Absatz 1 des Römer Statuts, wonach der Angeklagte während der Verhandlung anwesend zu sein hat.
Das Fürstentum Liechtenstein geht gemeinsam mit Botswana und Jordanien noch einen Schritt weiter: Sie schlagen – gestützt auf die bisherige Gerichtspraxis – vor, die Erfordernis der Präsenz von Angeklagten vor dem Strafgerichtshof durch eine Änderung der Verfahrens- und Beweisregeln des ICC zu lockern. Angeklagten, welche einer Vorladung unterliegen, soll ermöglicht werden bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Gesuch um Abwesenheit an die Verfahrenskammer zu stellen. Kommt diese zum Schlussdass solche ausserordentlichen Umstände vorliegen, soll das Gesuch bewilligt werden. Alternativ soll der Verfahrenskammer auch die Möglichkeit offenstehen, eine Verhandlung unter Nutzung moderner Telekommunikationsmittel, wie beispielsweise einer Videokonferenz, anzuordnen. Letztere Variante stellt einen innovativen Vorschlag des Staatentrios dar und müsste noch im Hinblick auf seine Praktikabilität präzisiert werden (z.B. Logistik, Finanzierung und Erstellung einer sicheren Verbindung). Beide Vorgehensweisen basieren auf einer flexibleren Interpretation des Artikels 63 Absatz 1 und weichen von der in dieser Bestimmung reflektierten angelsächsischen Tradition des Anwesenheitsverfahrens ab. Der Vorschlag würde dem Gericht aber in den Verfahren gegen Kenyatta und Ruto mehr Spielraum einräumen. So könnte beispielsweise in einer Krisensituation wie der Attacke der al Shabaab Miliz auf das Einkaufzentrum in Nairobi im September, zu deren Bewältigung die Leitung der Staatsgeschicke durch den Staatspräsidenten und seinen Vertreter unentbehrlich sind, die begrenzte Abwesenheit der Angeklagten respektive die Anordnung eines Tele-Verfahrens in Betracht gezogen werden.
Die Schweiz ist gefordert
Die gemachten Vorschläge sind begrüssenswert und bringen deutlich zum Ausdruck dass die Staatengemeinschaft die Schwierigkeit des Balanceakts zwischen der Führung eines Staates und der gleichzeitigen Verpflichtung, sich vor einem internationalen Strafgericht zu verantworten, anerkennt. Fraglich bleibt jedoch, ob die afrikanischen Staaten den gemachten Lösungsvorschlägen zustimmen werden oder ob das Entgegenkommen der Staatengemeinschaft, vor allem westlicher Staaten, für sie zu wenig weit geht. Ihre Forderungen verlangen weit mehr und zielen grob gesprochen darauf ab, amtierende Staatspräsidenten und Regierungschefs vor der Gerichtsbarkeit des ICC zu schützen. Das Unterfangen ist umso schwieriger, da die Diskussion um die Verantwortlichkeit afrikanischer Amtsträger oftmals mit der Geschichte westlicher Vorherrschaft in Afrika verknüpft wird. Vor diesem Hintergrund kommt der Schweiz mit ihrer Vizepräsidentschaft der Versammlung der Vertragsstaaten und mit dem Vorsitz der Arbeitsgruppe zu den Änderungen des Römer Statuts eine besondere Rolle zu, indem sie mit viel Geschick zwischen den Blöcken zu vermitteln hat.