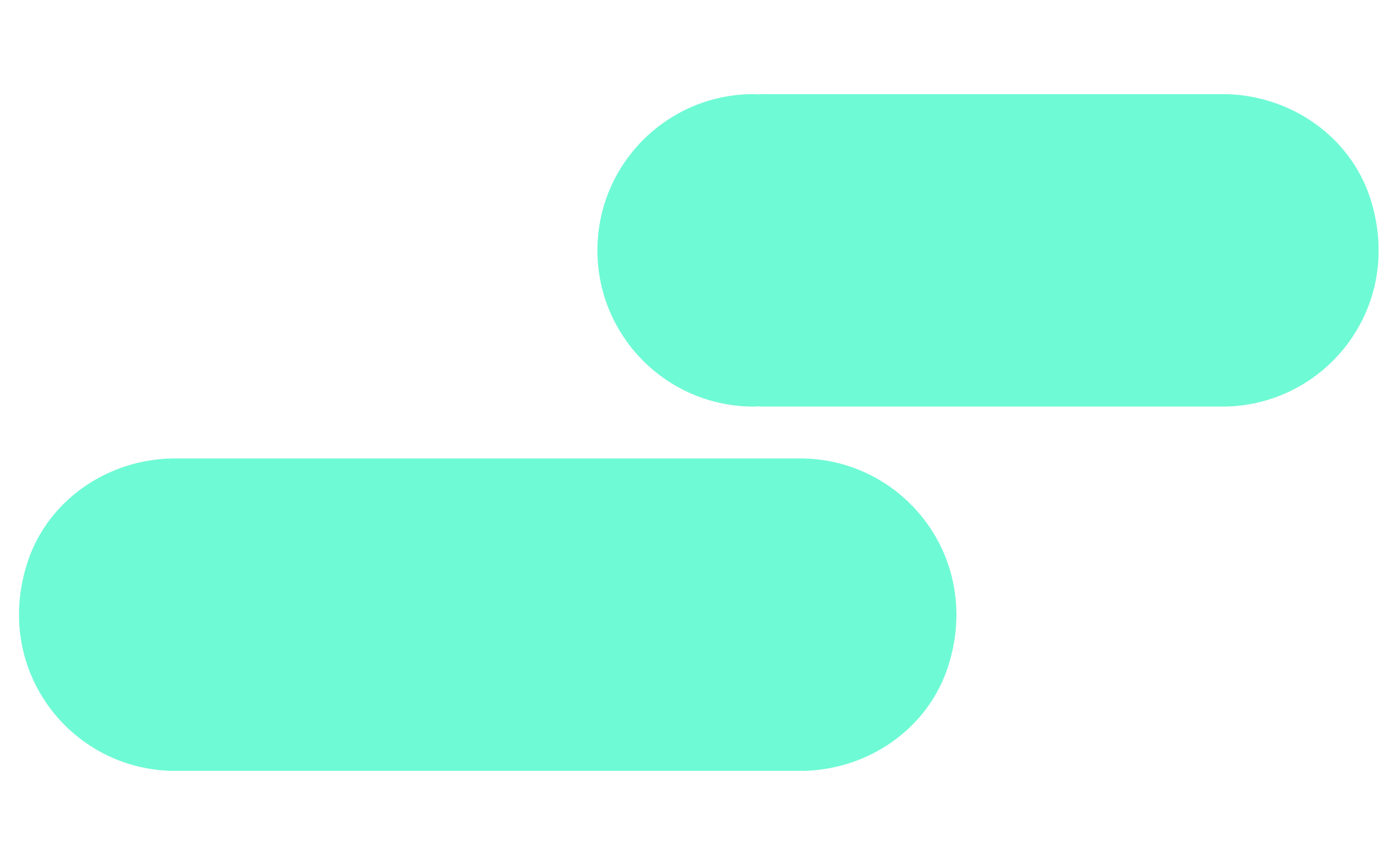Der Versorgungsengpass vor zwei Jahren für ein wichtiges Antibiotikum zeigte eine beunruhigende Abhängigkeit des Schweizer Gesundheitssystems von chinesischen Lieferanten auf. In Kombination mit einer zunehmenden Bedrohung durch multiresistente Keime entsteht eine Situation, welche auch die Schweizer Aussenpolitik fordert. Die Schweiz wäre gut beraten, ihre Versorgungssicherheitsstrategie für lebenswichtige Medikamente zu überdenken und entsprechend in Absprache mit anderen europäischen Staaten europaweite Lösungen zu finden.
Am 10. Oktober 2016 legte eine heftige Explosion die Fabrik der Qilu Pharmaceutical Company (QPC) in der chinesischen Stadt Jinan lahm. Was zuerst nur nach einem inländischen Zwischenfall aussah, nahm nach dem darauffolgenden weltweiten Lieferengpass für das Antibiotikum Piperacillin/Tazobactam internationale Dimensionen an. Es stellte sich unter anderem heraus, dass die beiden marktführenden Pharmafirmen in der Schweiz den für die Antibiotikaproduktion benötigten aktiven pharmazeutischen Zusatz von der QPC bezogen. Deren Ausfall führte zu Produktionseinbrüchen von rund 90%. Das Eidgenössische Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung musste daher im März 2017 auf Antrag des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung das Pflichtlager für das betroffene Antibiotikum freigeben und konnte damit akute Versorgungsengpässe in Schweizer Spitälern verhindern. Doch nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Staaten entstand ein akuter Mangel, welcher die Abhängigkeit von einer einzigen chinesischen Produktionsstätte verdeutlichte. Diese Abhängigkeit ist insbesondere auf eine Verlagerung der Produktion von antibiotischen Schlüsselsubstanzen in asiatische Länder zurückzuführen und könnte auch in Zukunft noch weiter zunehmen.
Die Wichtigkeit von Piperacillin/Tazobactam
Die Wirkstoffkombination Piperacillin/Tazobactam besitzt dank seinem Wirk- und Sicherheitsprofil eine wichtige Stellung innerhalb des Antibiotikaarsenals, da sie insbesondere bei Notfällen und Infektionen mit multiresistenten Keimen eingesetzt werden kann. Solche multiresistente Bakterien entwickeln sich zunehmend zu einem ernsthaften Problem: eine britische Studie schätzt, dass jedes Jahr mindestens 700’000 Menschen an einer Infektion mit multiresistenten Bakterien sterben und dass diese Zahl bis 2050 auf 10 Millionen ansteigen wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte kürzlich eine Liste mit den zwölf Bakterienstämmen, welche die grösste Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Bei allen drei als „kritisch“ eingestuften Keimgruppen ist Piperacillin/Tazobactam oft das Mittel der ersten Wahl. Die Wichtigkeit einer stabilen Versorgungskette von Antibiotika für das Schweizer Gesundheitssystem ist offensichtlich. Beunruhigend ist, dass Piperacillin/Tazobactam nicht das einzige Antibiotikum ist, welches von einem Lieferengpass betroffen ist: drugshortage.ch listet zurzeit über 500 Lieferengpässe bei Arzneimitteln, inklusive weiterer Antiinfektiva, in der Schweiz auf.
Versorgungsicherheit wird durch Abhängigkeiten in Frage gestellt
Die Lieferengpässe in der Schweiz sind auf eine längere Entwicklung zurückzuführen: Chinesische Produzenten der Vorprodukte für die Antibiotikaproduktion konnten durch aggressives Preisdumping alle europäischen Anbieter aus dem Markt drängen. Das letzte Werk in Frankfurt-Höchst, welches noch Piperacillin/Tazobactam hätte herstellen können, wurde im Januar 2017 geschlossen. Dazu herrscht ein grosse Abhängigkeit von Indien, welches einen Drittel des globalen Medikamentenbedarfs deckt. Indien wiederum bezieht über 90% aller pharmazeutischen Zusätze für die Produktion von essentiellen Medikamenten, insbesondere wichtigen Antibiotika, aus China. Dazu kommt, dass es keine Garantie gibt, dass China in Zukunft seine Monopolstellung in der Antibiotikaproduktion nicht für politische Zwecke benutzen wird. Eine politisch motivierte Verknappung von schwer zu substituierenden Stoffen konnte man bereits in den 2000er-Jahren beobachten, als China unter anderem den Export von seltenen Erden nach Japan blockierte. Ob China seine Marktmacht in der Antibiotikaproduktion jemals für seine politische Zwecke einsetzen wird, bleibt abzuwarten. Dass jedoch manche Beobachter aufgrund der fragilen Versorgungsketten und potentiellen Versorgungsengpässe vieler Antibiotika von einer Gefahr für die nationale Sicherheit sprechen scheint nicht ganz unbegründet.
Ansätze zur zukünftigen Versorgungssicherheit
Es gibt mehrere Ansätze, um die Versorgung von lebenswichtigen Behandlungsoptionen bei einer bakteriellen Infektion auch in Zukunft sicherzustellen. Diese sollten gleichzeitig verfolgt werden. Die Schweiz wird nicht umhinkönnen zu untersuchen, wie dies in Deutschland zurzeit der Fall ist, inwiefern die Produktion wichtiger Antibiotika wieder in die Schweiz, oder zumindest nach Europa, rückverlagert werden kann. Die Analyse aus Deutschland zeigt, dass ein Neuaufbau lokaler Antibiotikaproduktion grundsätzlich möglich ist, aber mit einigen Mehrkosten verbunden sein wird. Die Schweiz mit ihrer starken Pharmabranche könnte hier eine Führungsrolle übernehmen und zusammen mit anderen europäischen Ländern eine gemeinsame und kosteneffiziente Lösung erarbeiten. Dabei könnten sich unter anderem Synergien zwischen der Schweizer Pharmaindustrie und den noch bestehenden Produktionsstandorten in Deutschland ergeben. Zudem sollten auch Alternativen zu antibiotischen Behandlungsmethoden erkannt und weiter gefördert werden. Dabei muss insbesondere die Bakteriophagentherapie berücksichtigt werden, nicht nur wegen ihrer Wirksamkeit bei multiresistenten Bakterien, sondern auch aufgrund ihrer grundsätzlich zu Antibiotika verschiedenen Produktionsmethode. Da die Kompetenzzentren für diese Behandlungsmethode besonders in Staaten der ehemaligen Sowjetunion, allen voran Georgien, zu finden sind, sollte der wissenschaftliche Austausch im Bereich der Bakteriophagenforschung mit diesen Ländern speziell gefördert werden. Das Beispiel der Bakteriophagenforschung zeigt, dass die jetzigen internationalen Partnerschaften der Schweiz im Bereich Bildung, Forschung und Innovation weiter diversifiziert und spezifiziert werden sollte. Um die Versorgungssicherheit bei bakteriellen Infektionen auch in Zukunft zu gewährleisten, ist also nicht nur das Schweizer Gesundheitssystem und die inländische Pharmaindustrie gefordert, sondern auch die Aussenpolitik. Sie muss Wege aufzeigen, um die Produktion und Erforschung von bewährten sowie neuen Behandlungsmethoden im Ausland zu sichern.
Image: Pexels