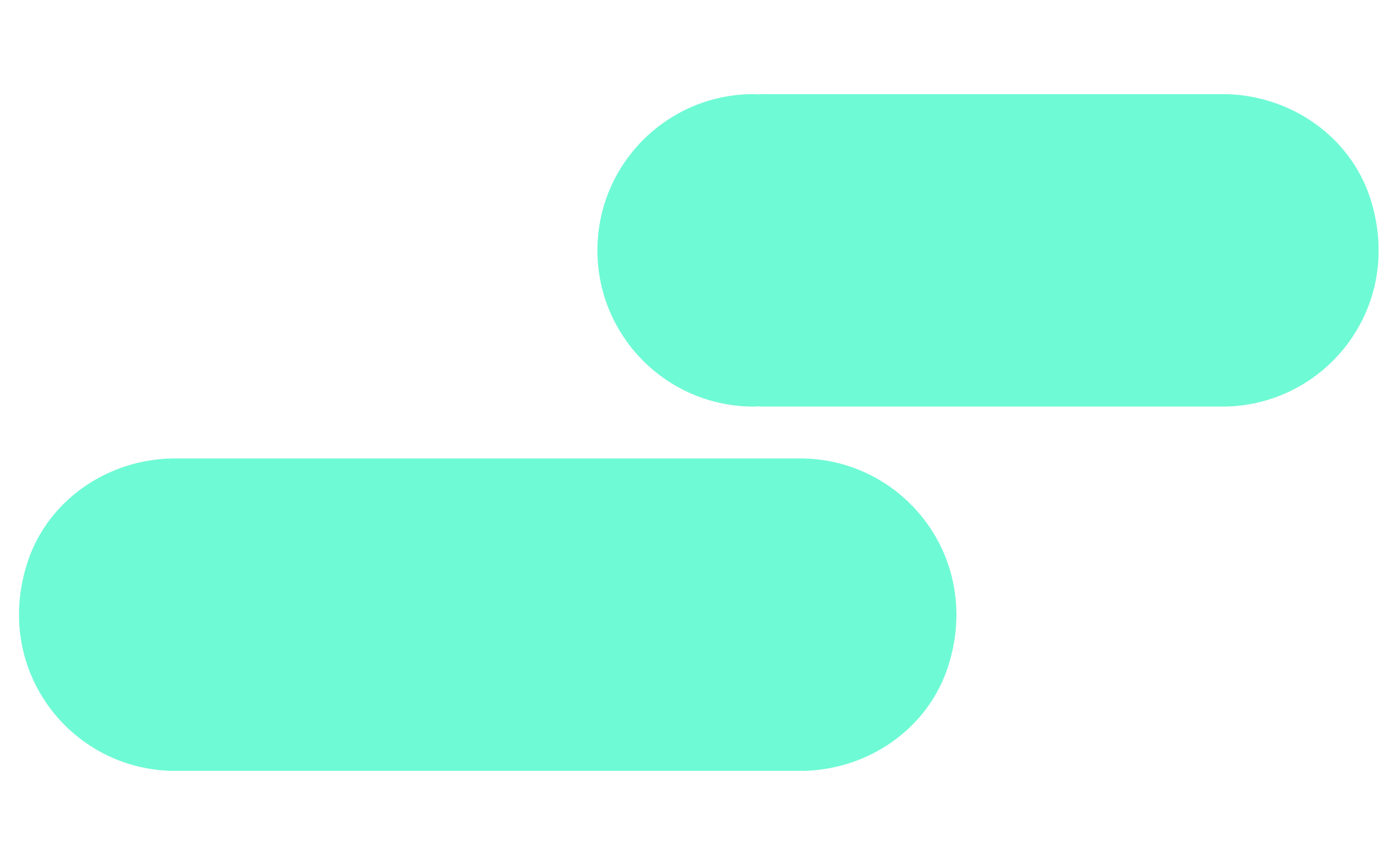Am 13. Juni stimmen wir über die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative ab. Die Fronten sind verhärtet. Die Gegner *innen wollen die heutige Schweizer Landwirtschaft schützen – die Befürworter*innen deren Fortbestand und unsere Zukunft.
Nach eigenen Angaben fährt der Bauernverband momentan die grösste Kampagne in seiner Geschichte. Auf dem Spiel steht der Status quo der heutigen Schweizer Landwirtschaft. Bedroht sieht ihn der Verband schon lange. Darum schlägt im Parlament Veränderungsvorschlägen aller Art heftiger Widerstand entgegen. Manchmal war dieser erfolgreich, wie etwa bei der sistierten Agrarpolitik für die nächsten Jahre, der AP22+. Manchmal hat es für eine Abschwächung gereicht, wie bei der parlamentarischen Initiative „Das Risiko beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren.“ Mit genau dieser Strategie wird nun seit Jahren verhindert, dass sich in der Landwirtschaftspolitik etwas bewegt.
Doch ist es überhaupt berechtigt, überhaupt gerecht, sich dem Wandel derart zu verweigern? Um diese Frage zu beantworten lohnt sich ein Blick auf die Klimadebatte in Deutschland. Dort hat das Bundesverfassungsgericht einen viel beachteten Entscheid getroffen. Es gab einer eingereichten Klage recht, indem es bestätigte: Das erarbeitete CO2 Gesetz ist verfassungswidrig, weil es dazu führt, dass kommenden Generationen ungleich viel mehr aufgebürdet wird, um das anerkannte Ziel Netto Null bis 2050 zu erreichen, als den heutigen Generationen. Die Versäumnisse der heutigen Generationen – inklusive entstehende Folgekosten – den kommenden Generationen aufzuladen ist also ungerecht. Das gilt für das Klima, aber das gilt eben auch für die Landwirtschaft. Denn auch hier geht es darum unsere Produktions- und Lebensgrundlagen so zu erhalten, dass die zukünftige Versorgung von uns und kommenden Generationen nicht eingeschränkt wird.
Dass aber genau das geschehen wird, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, das ist wissenschaftlicher Konsens. Sogar Christian Hofer, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, sagt in einem Interview mit der NZZ im Mai 2020: „Wenn die Landwirtschaft so intensiv weiterproduziert wie heute, ist die Versorgungssicherheit mittel- und längerfristig gefährdet“. Auch die Folgekosten, die durch die heutige Art der intensiven Produktion entstehen, sind inzwischen mehrfach beziffert, zuletzt von Alessa Perotti in ihrer Masterarbeit an der ETH Zürich. Sie sagt, dass für jeden Franken den wir für Lebensmittel ausgeben mindestens 90 Rappen externe Kosten (Gesundheitskosten, Kosten für Trinkwasseraufbereitungsanlagen, usw.) hinzukommen. Insgesamt wären das jährlich 70 Milliarden Franken, die uns die Lebensmittel kosten, statt der heutigen 37 Milliarden.
Doch woran wird eigentlich festgehalten? Wozu diesen Status quo so bis aufs Blut verteidigen, wenn es sonnenklar ist, dass es Veränderung braucht und vor allem, dass sie möglich ist? Ins Feld geführt werden Argumente wie die Gefährdung der Inlandversorgung oder eine zunehmende Abhängigkeit von Importen. Dabei würden das Ziel einer hohen Inlandversorgung eigentlich erstaunlich gut mit den Zielen der beiden Initiativen übereinstimmen. Nicht nur, weil durch den hohen Pestizideinsatz wichtige Produktionsgrundlagen wie fruchtbare Böden, sauberes Wasser und eine reiche Biodiversität gefährdet werden. Auch weil wir heute äusserst ineffizient produzieren. Eine Studie von Agroscope, der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt des Bundes, zeigt: mit weniger Tieren, einer pflanzenbasierten Ernährung und einer Reduktion des Foodwaste könnte der Versorgungsgrad sogar erhöht werden. Es gibt also bessere Modelle als heute, in denen die Umwelt geschont, die Versorgung kurz- und langfristig gesichert, die Folgekosten tief gehalten und die produzierten Lebensmittel gesund und vielfältig wären.
Also nochmals: Wer will, dass alles so bleibt wie es ist, wenn die Lösungen schon da sind? Dahinter stehen – ähnlich wie in der Klimadebatte – mächtige finanzielle Interessen: das Geschäftsmodell der Futtermittel-, Saatgut-, Düngemittel-, Pestizid- und Maschinenimporteure ist auf intensive Produktion angewiesen. Kein Wunder setzen sie alles daran, dass sich nichts ändert.
In den Vordergrund geschoben werden aber stattdessen ganz gezielt das Unwohlsein und die Ängste, die die Initiativen in bäuerlichen Kreisen auslösen. Denn obwohl sich auch dort viele Befürworter*innen insbesondere der Pestizid-Initiative finden, fühlen sich wohl viele in der Landwirtschaft Tätige durch die Initiativen bevormundet und in ihrem Berufsstolz verletzt. Das ist schade, denn die Bevormundung könnte man auch darin sehen, dass ihnen die Bewältigung des Wandels nicht zugetraut wird und ihnen vorgegaukelt wird, er liesse sich verhindern. Die Frage ist doch vielmehr, ob wir es schaffen, die Verantwortung für den Wandel gerecht zu verteilen. Denn betroffen sein werden wir alle. Ein erster Schritt wäre, den gemeinsamen Entscheid zu fällen: Ja, diese Art von Landwirtschaft wollen wir in zehn Jahren haben – und den Weg dorthin werden wir alle #gemeinsamgehen.