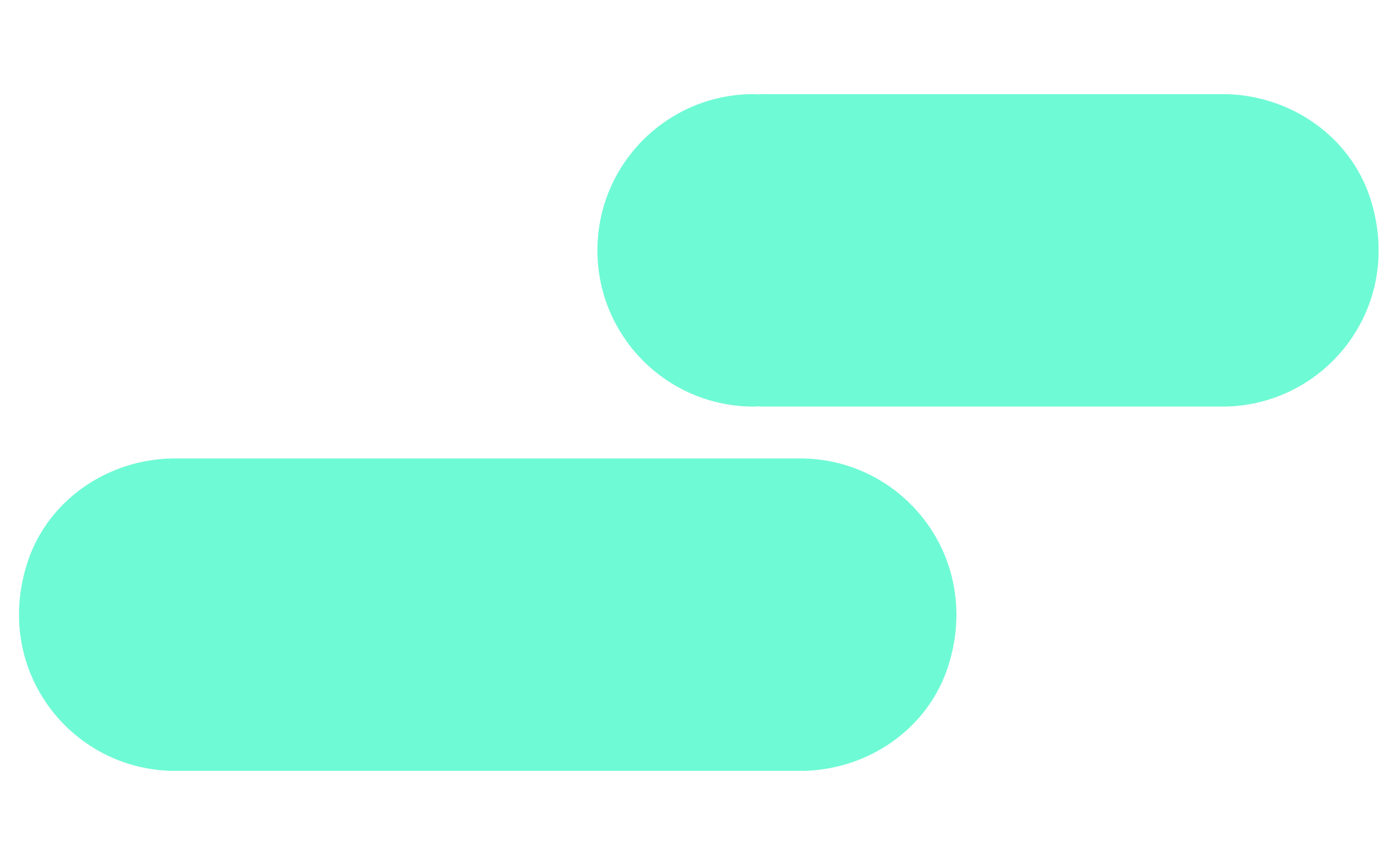Der Rapper Goran Vulović aka Milchmaa hielt an einem Diskussionsabend von foraus im Rahmen des Festivals CULTURESCAPES Balkan 2013 ein Einführungsreferat, in welchem er seine ganz persönlichen Erfahrungen schilderte, wie es ist als Secondo in der Schweiz aufzuwachsen. Wir erlauben uns diese zum Teil berührende Rede mit Einverständnis von Goran Vulović leicht verändert wiederzugeben.
Ich heisse Goran Vulović, bin 28 Jahre alt und befinde mich in der Ausbildung zum Gymnasiallehrer. Ich arbeite bereits als Geschichts- und Deutschlehrer an verschiedenen Mittelstufenschulen in Zürich und Umgebung. Seit 10 Jahren rappe ich unter dem etwas unvorteilhaften Künstlernamen „Milchmaa“ auf Schweizerdeutsch und im August dieses Jahres habe ich mein neues Album mit dem Titel „-ić” veröffentlicht.
Dieses Album ist eine subjektive Auseinandersetzung mit Herkunft und Identität und hat in den nationalen Medien grossen Anklang gefunden, ganz entgegen meinen Erwartungen. Ich denke, dass ich mich durch die Kombination aus Rapper mit Migrationshintergund aus dem Balkan, Osteuropahistoriker und Gymi-Lehrer für viele Medien als interessanter Gesprächspartner für Themen wie Integration und Migration angeboten habe.
Dabei ist mir nicht ganz klar, was genau von mir erwartet wird. Denn technisch gesehen bin ich kein Immigrant. Ich wurde in der Schweiz geboren, bin hier aufgewachsen, ich spreche Deutsch, vor allem Bündnerdeutsch, besser als meine Muttersprache Serbisch, ich bin stolzer Churer, habe viele Schweizer Freunde, hatte viele Schweizer Freundinnen, habe hier meine Ausbildung genossen, die Staatsbürgerschaft erkauft, somit sogar den Militärdienst geleistet und ich erfülle auch alle anderen staatsbürgerlichen Pflichten.
Ich bin ein sogenannter Secondo und bilde somit streng betrachtet den Abschluss eines Migrations- und Integrationsprozesses. Ich bin sozusagen ein Ergebnis dieser Vorgänge, das hier als Beispiel für eine abschliessende Bewertung des Einwanderungslandes Schweiz dienen könnte. Natürlich möchte ich kein Untersuchungsobjekt sein. Vielmehr möchte ich auf diese Weise auf etwas Anderes aufmerksam machen. Nämlich dass ich mich trotz allem nicht als Schweizer bezeichnen würde. Wenn mich jemand fragt, was ich denn sei, dann antworte ich selbstverständlich: Serbe. Obwohl ich Serbisch mit Akzent spreche und mir die sieben Fälle meiner Muttersprache grosse Mühen bereiten, obwohl ich immer weniger Zeit bei meinen Verwandten in Serbien verbringe, obwohl meine Mutter, die mich alleine aufgezogen hat, nie viel mit Patriotismus, geschweige mit Nationalismus oder dem christlich-orthodoxen Glauben anfangen konnte, obwohl ich im Belgrader Bürokratie-Moloch von unfreundlichsten Schalterzicken wie der allergrösste Abschaum behandelt wurde, weil ich eben in der Diaspora wohne und einen neuen serbischen Pass beantragen wollte. Und dennoch antworte ich: Ausländer, Serbe.
Weshalb nur? Diese Frage war der Anstoss zu meiner musikalischen Auseinandersetzung mit meiner Identität und Herkunft. Ich möchte versuchen einige Antworten darauf zu geben, auch mit Bezug auf meine Rap-Texte.
Ich habe vor einiger Zeit meinen Ausländerausweis mit Niederlassungsbewilligung C gefunden, den letzten bevor meine Mutter uns einbürgern liess, damit man uns nicht aus der Schweiz wirft, wie sie mir damals erklärt hatte. Auf meinem Ausländerausweis steht unten rechts mein Einreisedatum. Da steht „Einreisedatum: 12.09.1984“. Das ist mein Geburtsdatum. Im Schweizer Beamtenjargon bin ich somit nicht in der Schweiz auf die Welt gekommen, sondern ich bin mit meiner Geburt in die Schweiz eingereist. Man stelle sich vor: Der Muttermund als Grenze, die Hebamme als Zöllner und der Klapps auf den Hintern als Willkommensgruss.
Genau dieser Widerspruch, ich empfinde es zumindest als einen, dass ich als zweite Generation, die in einer Willensnation, wie es die Schweiz ist, geboren wurde, mich immer noch als Ausländer bezeichne, fühle und auch angesehen werde, hat mich die letzten Jahre beschäftigt und mich zu vielen Liedern auf meinem Album inspiriert. Ob ich eine Erklärung dafür gefunden habe? Für mich, ja. Für andere, vielleicht. Die grosse Ressonanz auf meine Musik von vielen Menschen aus der ganzen Schweiz mit ähnlichem Hintergrund bestätigt mir aber auf jeden Fall, dass ich mich nicht bloss in eine persönliche Identitätskrise hinein gestürzt habe, sondern mit meinen Texten Dinge anspreche, über die viele Leute auch schon gegrübelt und sich bereits eine Meinung darüber gemacht haben.
Als Historiker wollte ich mit Methode an die Beantwortung meiner Initialfrage herangehen, natürlich unter Berücksichtigung gängiger Rap-Standards. So ging ich in einem Lied zuerst mal der Frage nach, weshalb ich überhaupt in der Schweiz bin, sprich weshalb sind meine, sagen wir, unsere Eltern vor Jahrzehnten hierher gekommen. Mit welchen Absichten und welchen Hoffnungen? Um es kurz zu fassen, meine wichtigste Erkenntnis ist, dass unsere Eltern nicht gekommen sind, um zu bleiben. Die erste grosse Einwanderungswelle vor dem Bürgerkrieg – die Gastarbeiter, sicher nicht die zweite danach, die Flüchtlinge – hatte bestimmt auch die leise Hoffnung, irgendwann mal wieder in ihr Land zurückkehren zu können. Man darf nicht unterschätzen, welch ein schwieriger Schritt das sein muss, seine Heimat zu verlassen, egal welche schlimmen Verhältnisse dort herrschen.
Bei unseren Eltern stellte sich somit mit der Zeit und vor allem mit dem Bürgerkrieg eine Ernüchterung ein oder wie ich das am Bespiel eines Gastarbeiter-Pärchens in einem Lied schildere: „Er nimmt sie an dr Hand und striichelt ihri Finger und seit I glaub miar blieben do für immer.“
Welche Konsequenzen hatte das für uns Kinder? Nun gemäss unseren Eltern sollten wir eigentlich gar nicht in der Schweiz sein, es war nicht wirklich beabsichtigt. Wir haben zwar die Sprache gelernt und viele Sprachen beherrschen ist immer gut. Zuhause, manchmal auch in dafür vorgesehenen Schulen, sollte aber die Muttersprache gepflegt und vor allem nicht vergessen werden, denn wir müssen uns ja in Zukunft „unten“ noch verständigen können. Wir haben auch hier die Schule besucht, aber eben nur vorübergehend, bis wir dann nächstes oder übernächstes Jahr „unten“ eingeschult werden. Die Schulausbildung bei uns sei ohnehin viel besser. Es gab also auch keinen Grund, sich über das komplizierte Schweizer Schulsystem zu informieren. Und in den Sommerferien fuhren wir selbstverständlich „nach Hause“ für zwei, drei Wochen.
Diese Ausführungen sollen auf keine Weise einen Vorwurf an unsere Eltern sein. Es ist nur verständlich und leicht nachvollziehbar, dass sie unsere Zukunft in ihrem Heimatland sahen.
Als dann eben die Erkenntnis eintrat, dass es höchstwahrscheinlich keine Rückkehr mehr geben wird, wurden manche unserer Eltern zu Zynikern: „Jugo si, heisst au kei Gegawart ha, dini Eltera erinneren die jeda Tag dra, dass es früahner dunna besser xi isch und du do übermorn schu vergessa si wirsch.“
Man vermittelte uns, mittlerweile, Jugendlichen, dass uns diese „bessere Welt der Heimat“ für immer verweht bleiben wird, mehr noch sogar. Wir werden Schweizerinnen und Schweizer heiraten, unsere Kinder werden wahrscheinlich unsere Sprache nicht mehr verstehen können und es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir alle unsere Herkunft vergessen werden, dass wir spurlos aufgehen werden in der Schweiz. Manche Schweizer Politiker würden diesen Vorgang fälschlicherweise als Integration bezeichnen. Wir haben also die Situation, dass der zweiten Generation ein Identitätsmanko vorgeworfen und ein Identitätsverlust prophezeit wird, zumindest was die nationale Zugehörigkeit anbelangt. Die Verwandten „unten“ haben dieses Urteil schon länger gefällt, für die waren wir stets die „Schwaben“, wie in Ex-Jugoslawien alle Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, leicht abschätzig, kollektiv bezeichnet werden. In den 1990ern hatten wir eine gänzlich ungünstige Ausgangslage für einen Jugendlichen mit Herkunft aus dem Balkan, für den mit der Pubertät ohnehin Zugehörigkeit eine immer wichtigere Rolle im Leben spielte. Zu dieser allgemeinen Orientierungslosigkeit kommt noch diejenige der Eltern dazu. Denn man darf nicht vergessen, dass mit dem Zerfall des sozialistischen Jugoslawiens auch viele Eltern einen herben Identitätsverlust erlitten hatten und sich zuerst neu orientieren mussten.
Die jungen Secondos benötigen also alternative Quellen, um sich ihrer nationalen Identität und ihrer Einordnung in der Schweizer Gesellschaft bewusst zu werden. Und hier kommen die Medien ins Spiel.

Goran Vulović aka Milchmaa
Der Balkan hat schon seit Jahrhunderten ein akutes Imageproblem. Öfter als man vermuten mag, haben verschiedene internationale Medien dieses negative Bild nicht nur geschürt, sondern auch konstruiert. In diese Tradition der Negativwahrnehmung haben sich auch die Jugoslawienkriege der 1990er eingeordnet, die nach dem Vietnamkrieg der medial meistausgeschlachtete Konflikt der Menschheitsgeschichte sind. Diese mediale Omnipräsenz hatte dann auch schnell Auswirkungen auf dem Pausenplatz. Plötzlich, so schien es, war man der „Scheiss-Jugo“. Nicht dass die Kinder in der Schule wirklich eine Ahnung hatten, was sie da einem nachriefen, aber es gibt eine Vorstellung davon, wie im Elternhaus über das aktuelle Thema der Jugoslawien-Flüchtlinge gesprochen wurde.
Als Serbe in der Schweiz hat man gleich zwei Mal den Schwarzen Peter gezogen: Man ist nicht nur ein „Jugo“, sondern auch noch die völkermordende, massenvergewaltigende, nazi-kommunistische Variante davon. Und die Medien berichteten fleissig sowohl über die Verbrechen der Landsmänner „unten“, als auch über diejenigen hier in der Schweiz. Wenn man dann neben der medialen Hetzjagd noch aufgrund der Herkunft in der Schule, bei der Lehrstellen- oder Wohnungssuche diskriminiert wird, entsteht ein sehr fruchtbarer Nährboden für Komplexe. Ich möchte hier nicht auf meine persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung eingehen, weil ich mich in der Opferrolle nicht wohl fühle und weil ich diese ohnehin für nicht sehr produktiv halte, wenn es um solche Themen geht. Ich fühlte mich damals ein bisschen wie Andri aus Max Frischs „Andorra“, dem man versuchte von aussen definierte Identitäten über zu stülpen. Und wenn man eben nicht in der Lage ist, sich eine eigene Selbstwahrnehmung aufzubauen, besteht die Gefahr, dass man sich mangels Alternativen diese fremdbestimmten Stereotypen aufdrängen lässt: „Iar müand gar nit so blöd drigaffa, wenn miar mol so werden, wia iar es üs ständig wiismacha wend.“
Es ist nicht zufällig, dass meine Thesen an die „Balkanismus“-Theorie von Maria Todorova erinnern. Ich habe sogar ein Lied nach dieser bulgarischen Historikerin benannt. Bei Todorovas Begriff „Balkanismus“ handelt es sich, um die hartnäckigste kognitive Schablone des Westens, mit der stets eine Herabsetzung und Negativwahrnehmung der Balkanregion einhergeht. Dieser über die letzten 200 Jahre geformte westliche Balkandiskurs führt in seinen letzten Konsequenz eben auch dazu, dass die Balkanvölker beginnen, sich selbst durch pejorative Vorurteile von ausserhalb zu definieren.
Um somit auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen, weshalb ich mich denn immer noch als Serbe bekenne: Weil ich eben unabhängig von meiner Person und meinen Taten nie als Schweizer angesehen oder wie einer behandelt wurde. Weil ich zum Ausländer geformt wurde. Zusätzlich hat man mir von ausserhalb auch ständig versucht, dieses „Jugo-sein“ samt den damit zusammenhängenden Stereotypen einzutrichtern. Typisch „Jugo“ dies, typisch „Jugo“ das. Analog zum typisch „Schweizer“ der Eltern. Man ist ein sehr anfälliger Spielball zweier Welten: „Ab und zua bin I meh Schwizer als miar liab isch, meh Michi als miar liab isch, meh Wixer als miar liab isch, was das bedütet, I han leider kei Plan, I glaub I möchti säga, dass dr ganzi Scheiss-Tag, I hin und her pendla zwüscha idealisiarter und realer Heimat, was hend iar us miar gmacht?“
So banal und auch vielleicht enttäuschend meine Antworten sein mögen, so folgenschwer können sie für die Schweiz werden. Denn es gibt hier mittlerweile dieses Bewusstsein, dass man Ausländer ist und was noch viel schlimmer ist, dass man eben Ausländer bleibt. Bei der ersten Generation ist diese Selbstbezeichnung absolut nachvollziehbar und bei den Secondos teilweise auch, wie ich es versucht habe, darzulegen. Aber wenn mir Jugendliche der dritten Generation während des Deutschunterrichts sagen, dass sie es nicht besser können, weil sie eben nur Ausländer sind, dann läuft etwas schief in der Schweiz. Wenn sich also bereits die dritte Generation auf diese Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung eines benachteiligten, minderwertigen, ungebildeten oder aggressiven Ausländers reduziert, sollte man sich fragen, woran das liegt und ob die Schweiz nicht das Potenzial ihrer Immigranten verkennt.