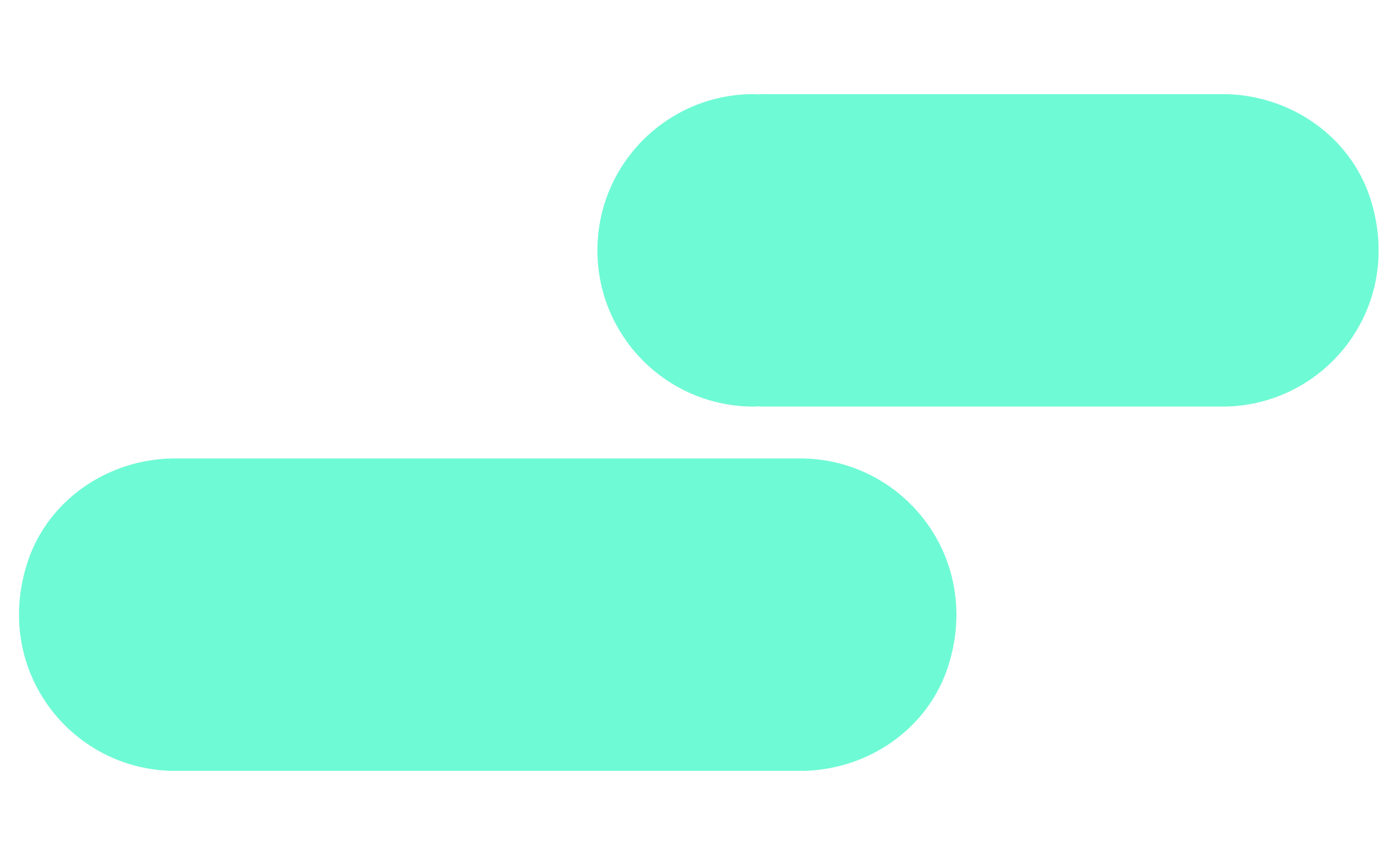Von Fabian Urech – Die geforderte Kopplung von Asyl- und Entwicklungspolitik sorgt für viel Lärm und Polemik. Dabei zeigt ein nüchterner Blick in die Statistik, dass die Schweiz diese Praxis kaum umsetzen könnte. Ein partnerschaftlicher Dialog ist den Interessen des Landes dienlicher.
Die steigende Zahl von Asylgesuchen hat in der Schweiz neuerlich eine intensive Migrationsdebatte entfacht. Im Zentrum steht aktuell die Frage, ob die Schweiz die Entwicklungshilfe als Hebel benutzen kann, um die Rückführung von Migranten zu erwirken. Entsprechende Motionen der FDP und SVP werden am 8. März im Ständerat behandelt.
Wie effektiv ist die Anwendung dieser negativen Konditionalität als Druckmittel zur Durchsetzung schweizerischer Interessen im Asylbereich? Peter Niggli und Stefan Schlegel haben sich in kürzlich veröffentlichen Beiträgen entschieden gegen eine Kopplung von Asylpolitik und Entwicklungszusammenarbeit ausgesprochen. Niggli rechnet vor, dass lediglich 38,4 Prozent aller Asylsuchenden aus Staaten stammen, in der die Schweiz langfristige Entwicklungszusammenarbeit betreibt. Zudem würde die Schweiz mit einer strikten Umsetzung dieser Massnahme ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen beschneiden.
Auch Stefan Schlegel glaubt nicht, dass die Drohung der Schweiz, die Entwicklungszusammenarbeit zu streichen, die Regierungen der Herkunftsländer dazu veranlasste, ihre Migrierenden zurückzunehmen. Der Rückfluss von Geld der eigenen Ausgewanderten (Remittances) übersteige in den meisten Fällen die Entwicklungszahlungen der Schweiz. Finanzielle Anreize bestünden deshalb kaum, zumal Regierungen nur in wenigen Fällen direkt von Hilfszahlungen profitierten, so Schlegel.
Schweizer Entwicklungshilfe: als Druckmittel ungeeignet
Inwieweit haben diese Argumente Gültigkeit mit Blick auf den Einzelfall, d.h. auf die bilateralen Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Herkunftsländern von Asylsuchenden? Ein Blick in die Statistik gibt Aufschluss. Die Zusammenstellung einiger Grunddaten im Zusammenhang mit den fünfzehn wichtigsten Herkunftsländern von Asylsuchenden lässt folgende Schlüsse zu:
1. Die Entwicklungszahlungen der Schweiz an die fünfzehn Staaten sind im Vergleich zur Gesamtsumme der Entwicklungshilfe, die diese Länder erhalten, marginal. Es ist kaum vorstellbar, dass sich etwa die 17.6 Millionen CHF als Hebel benutzen lassen, um Afghanistan, das jährlich insgesamt 6‘374 Millionen US $ (5‘713 Mio. CHF) Entwicklungshilfe erhält, zur Kooperation zu bewegen. In zwei Dritteln der Staaten betrugen die Schweizer Entwicklungszahlungen im Jahr 2010 weniger als 10 Mio. CHF; gleichzeitig erhielten im selben Jahr neun der fünfzehn Länder insgesamt über 500 Mio. US $ Entwicklungshilfe.
2. Mit der Ausnahme Syriens übertreffen die Rücküberweisungen von Ausgewanderten die Entwicklungszahlungen der Schweiz. In vielen Fällen ist die Differenz beträchtlich: bei Sri Lanka beträgt das Verhältnis zwischen geleisteter Entwicklungshilfe und der Gesamtsumme der Rückzahlungen 1:6, bei Mazedonien 1:2,5 und bei Algerien gar 1:55.
3. Die Schweiz weist gegenüber allen Staaten, zu denen Daten zugänglich sind, eine positive Handelsbilanz auf. In drei Vierteln der bekannten Fälle beträgt der Exportüberschuss mehr als 100 Mio. CHF.
Die von Niggli und Schlegel vorgebrachten Argumente scheinen mehrheitlich zuzutreffen. Die aktuellen Statistiken zeigen auf, dass eine Kopplung von Entwicklungs- und Asylpolitik kaum den gewünschten Effekt haben dürfte. Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass die Schweiz in vielen der betroffenen Länder nicht unbedeutende wirtschaftliche Interessen hat. Diese durch eine strikte Umsetzung einer weitgehenden wirkungslosen Konditionalität der Entwicklungshilfe zu riskieren, wäre fahrlässig.
Dialog und Interessensausgleich
Das Problem bleibt damit ungelöst und bedarf neuer Lösungsansätze. Die Schweiz als Kleinstaat ist gut beraten, auch in der Asylpolitik auf den Dialog im Sinne eines Interessensausgleichs zu setzen. Entwicklungshilfe kann als Anreiz, kaum jedoch als Druckmittel eingesetzt werden Für ein einseitiges Vorgehen und die Anwendung von strikten Konditionalitäten verfügt die Schweiz in den meisten Fällen nicht über die benötigte Verhandlungsmacht.
Das vom Bundesrat lancierte Gefäss der Migrationspartnerschaften stellt eine vielversprechendere Alternative dar. Sie zielt darauf ab, bilaterale Migrationsabkommen in Berücksichtigung der Interessen „sämtlicher Partner“ abzuschliessen und „konstruktive Lösungen“ für die Herausforderungen der Migration bereitzustellen. Eine funktionierende Partnerschaft bedingt allerdings die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen und die Interessen der Gegenseite zu berücksichtigen. Wie erfolgreich die Schweiz dieses Prinzip in den vier bereits bestehenden Migrationspartnerschaften umzusetzen vermag, ist noch kaum abzuschätzen. Sich jedoch vorzeitig vom partnerschaftlichen Dialog zu verabschieden im falschen Glauben, dadurch die aktuellen Probleme lösen zu können, hiesse einzig einer populistischen Logik zu folgen und wäre weder effektiv noch im Interesse der Schweiz.
Was baucht es, um diese nüchternen Tatsachen ins Zentrum der emotional geladenen Migrationsdebatte zu rücken?
Fabian Urech wohnt in Bern. Er studiert Internationale Beziehungen und Politikwissenschaften in Genf und ist Mitglied des Redaktionsteams des foraus-Blog.
Der foraus-Blog ist ein Forum, das sowohl den foraus-Mitgliedern als auch Gastautoren/innen zur Verfügung gestellt wird. Die hier veröffentlichten Beiträge sind persönliche Stellungsnahmen der Autoren/innen. Sie entsprechen nicht zwingend der Meinung der Redaktion oder des Vereins foraus.