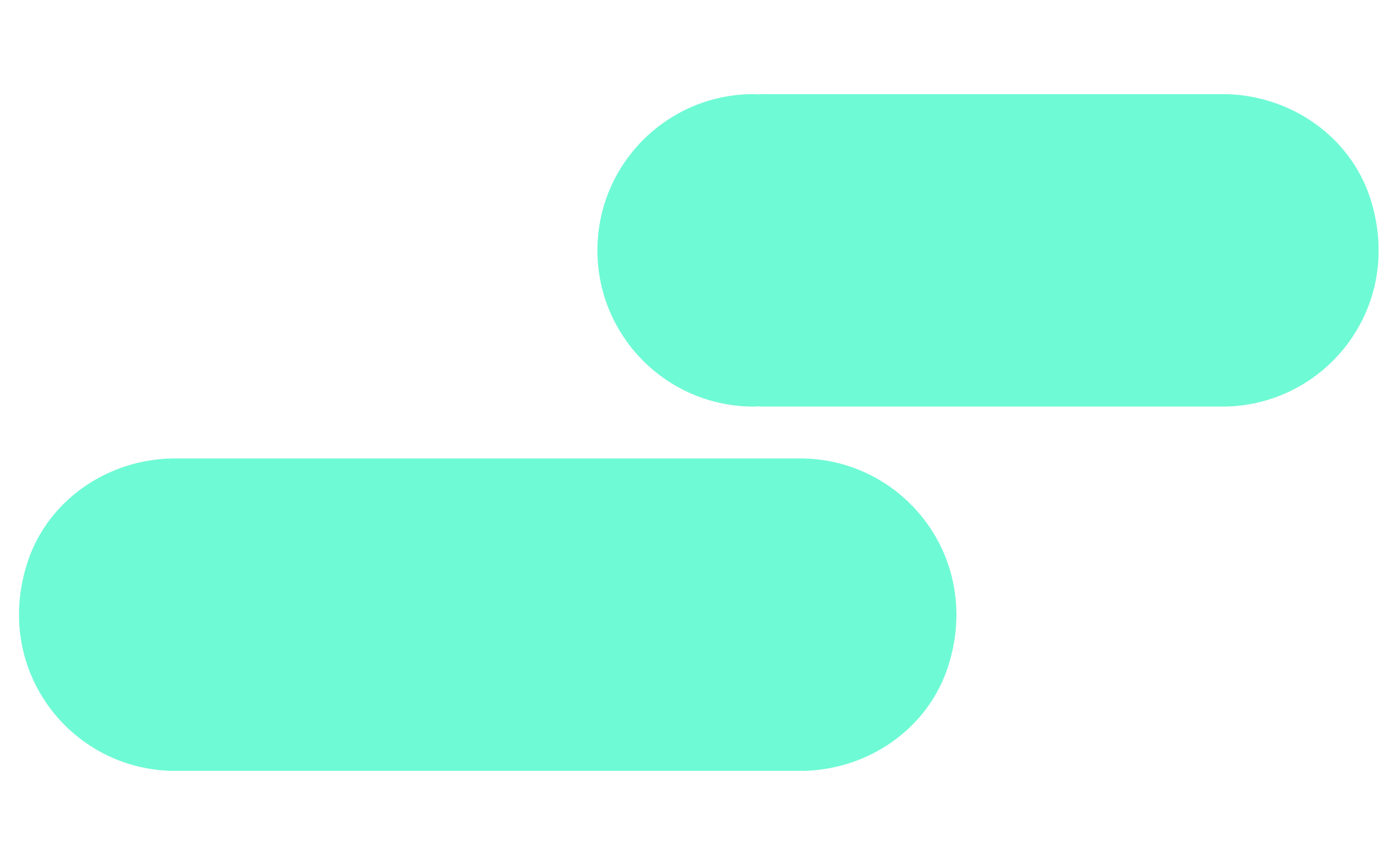Nationalismus und Faschismus gleichzusetzen ist nur ein kleiner Schritt für den Zeitungsleser, doch ein großer Schritt für die russische Propaganda. Ist die politische Rechte der Ukraine wirklich anders oder gefährlicher als diejenige in Europa oder Russland?
Bürgerkriege sind so brutal, weil die Front mitten durch eine Gesellschaft verläuft. Das soziale Gefüge zerfällt plötzlich in Alliierte und Feinde. Die meisten Menschen jedoch sind erst bereit auf andere zu schießen, nachdem diese über lange Zeit einer öffentlichen Entmenschlichung unterzogen wurden. Eine Gruppe, die am Ausbruch eines bewaffneten Konfliktes interessiert ist, entwickelt deshalb eine Propagandasprache, die künftige Feinde ihrer Menschlichkeit beraubt und damit auch ihrer Eigenschaften als Nachbarn, Kollegen, Freunde, Verwandte etc. Bevor es 1994 in Ruanda zum Völkermord kam, schürte die Radiostation „mille collines“ monatelang den Hass auf Tutsi und gemäßigte Hutu. Die zukünftigen Opfer wurden gemeinhin als „Kakerlaken“ bezeichnet. In der Ukraine müssen wir nun beobachten wie die Bezeichnung „Faschist“ die Funktion der Entmenschlichung übernimmt.
In der ehemaligen Sowjetunion nimmt der Zweite Weltkrieg einen sehr prominenten Platz in der Rezeption der Geschichte ein. Das ist nachvollziehbar, denn kein anderes Land hatte so viele Opfer zu beklagen wie die Sowjetunion. Das Trauma der faschistischen Verbrechen, genauso wie der Stolz sie überwunden zu haben, ist Teil einer immer gegenwärtigen Erinnerungskultur. In der Ukraine gehörten zum Faschismusdiskurs auch immer die Ukrainische Aufstands Armee (UPA), die in den 40er Jahren einen Guerillakrieg gegen die Rote Armee führte und sich am Massenmord an Juden und Polen beteiligte. Ihr bekanntester Anführer hieß Stepan Bandera, daher die Bezeichnung „Banderovci“ für die ukrainischen Faschisten.

„Die faschistische Bestie entkommt ihrer Strafe nicht!“ Montage aus einem sowjetischen Plakat von 1942 und einer UPA-Flagge, herumgereicht auf der social media Seite Vkontakte (quelle: vk.com)
Eine allgemein akzeptierte Definition von Faschismus gibt es nicht, dafür wurde der Begriff schon zu früh zu beliebig verwendet. Nach der Macmillan Enzyklopädie der Sozialwissenschaften ist Faschismus primär das politische System Italiens von 1922-45. Außerdem wird der Begriff als Prototyp des Totalitarismus verwendet, für politische Systeme die jenem Italiens gleichen. Verbindende Merkmale waren extremer Nationalismus, Antikommunismus und das Ablehnen einer parlamentarischen Demokratie. Seit dem Zerfall der Sowjetunion hat der Begriff „Faschismus“ in der russischen Umgangssprache jedoch ein unerfreuliches Eigenleben entwickelt. Die Tendenz geht dahin, dass mittlerweile fast jede politische Äußerung, die sich gegen den Kreml richtet als „faschistisch“ bezeichnet werden kann. Als die Stadtverwaltung der estnische Hauptstadt Tallin 2007 ein sowjetisches Soldatendenkmal versetzen ließ, lief im russischen Fernsehen eine wütende Kampagne gegen die „estnischen Faschisten“ an, getragen von der Jugendorganisation der Kremlpartei „Einiges Russland“.
Seit es im Dezember letzten Jahres in Kiev zu Demonstrationen gegen die korrupte Janukovič-Regierung kam, war die Bezeichnung Faschist wieder in aller Munde, nicht nur in russischen Medien, sondern auch bei einigen westlichen Beobachtern. So kritisierte etwa der Guardian bereits im Januar durchaus zurecht die Berichterstattung über den Maidan, übernahm dabei aber auch die fatale Faschismusrhetorik. Mitten in einer ansonsten treffenden Analyse der Situation in der Ostukraine schreibt auch die WOZ über die prorussischen Separatisten, sie seien eine soziale Bewegung gegen den Faschismus. Es gibt nichts daran zu deuteln, auf dem Maidan standen viele Nationalisten und die zahlreichen schwarzroten UPA-Flaggen verrieten, dass Rechtsradikale mitdemonstrierten. Doch die Masse der Demonstranten war nicht von einer faschistischen Vision getrieben. Sie träumten nicht vom Führerprinzip, nicht von einer militaristischen Gesellschaft und nicht von der Abschaffung der Demokratie.
Von Faschisten und Banderovci
Die Demonstranten auf dem Maidan und die von ihnen an die Macht gebrachte Übergangsregierung als „Faschisten“ und „Banderovci“ zu bezeichnen, verzerrt nicht nur die Erinnerung an die Verbrechen der Faschisten, sie macht aus ihnen auch entmenschlichte Kriegsfeinde. Es wäre viel präziser die Maidan-Bewegung und die neue ukrainische Regierung als Nationalisten verschiedener Abstufungen zu betrachten, was eigentlich schon schlimm genug ist. Das Problem dabei; ein Nationalismus ist dem anderen nicht vorzuziehen. Da Putin sich selbst zunehmend nationalistische Ergüsse erlaubt und seine europäischen Bewunderer sich offen zu dieser Ideologie bekennen, eignet sich „Nationalismus“ kaum mehr als verunglimpfende Bezeichnung. Ukrainische Nationalisten kollektiv als Faschisten zu bezeichnen führt zu dem falschen Eindruck sie seien ideologisch gefährlicher als russische, schweizerische oder französische Nationalisten, die in nationalen- und EU-Wahlen triumphieren. Es ist eine Übernahme der russischen Propagandasprache, die nahe legt, die neue ukrainische Regierung könne nur mit Waffengewalt davon abgehalten werden, die Verbrechen der faschistischen Angreifer von 1941 zu widerholen.
Die Außenpolitik Europas und der Schweiz muss sich nun an den schmalen Grat der Vernunft halten, zwischen der russischen Faschismus-Hysterie und einer tatsächlich problematischen Vision eines kulturell und sprachlich homogenen ukrainischen Nationalstaates. Die neue ukrainische Regierung sollte darin unterstützt werden, das Gewaltmonopol im Land wiederherzustellen. Danach aber sollten die westlichen Partner die ukrainische Regierung darauf drängen, kulturelle Unterschiede im Land nicht länger als Bedrohung zu behandeln und sie mit administrativen Mitteln einzuebnen. Stattdessen sollte das Land eine föderale Struktur erhalten und eine Verfassung die ganz klar anerkennt, dass die Ukrainer eines von vielen Völkern sind, die in der Ukraine leben und Ukrainisch eine von mehreren Sprachen, die dort gesprochen werden. Leider weisen kürzlich abgehaltene Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz und in Europa eher darauf hin, dass auch bei vielen europäischen Wählern die Formel eine-Kultur-pro-Land hartnäckig festsitzt.