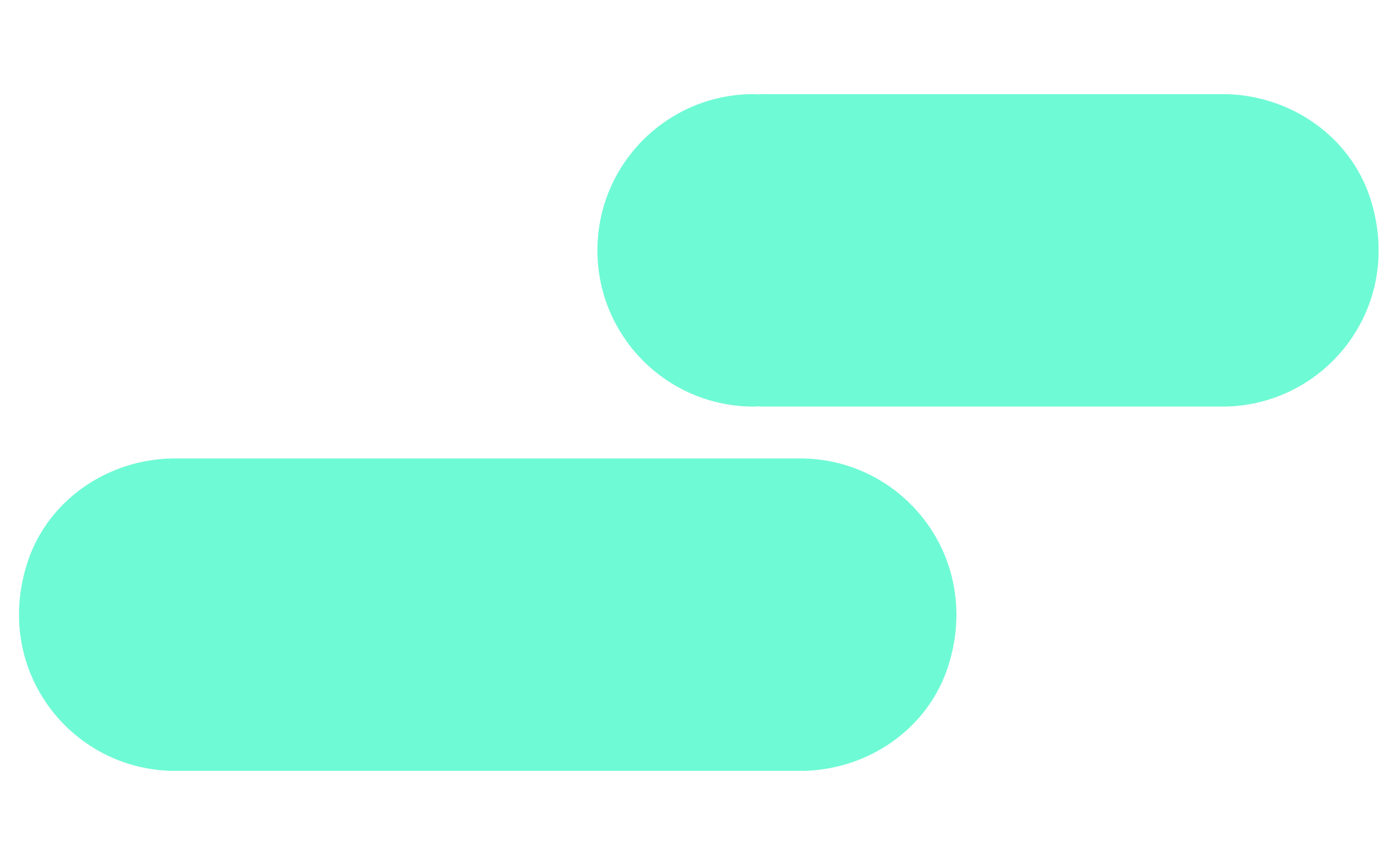Von Dominik Elser – Das Verhältnis zwischen der Schweiz und den USA bleibt in den nächsten vier Jahren unverändert. Es werden weiterhin hervorragende Beziehungen gepflegt. Und im einzigen Streitpunkt – dem Steuerdossier – wird sich die US-amerikanische Position nicht ändern. Was kann die Schweiz unternehmen? Und was wäre unter Mitt Romney anders?
Die Schweiz ist und bleibt in den USA beliebt. Sie gehört zu den wichtigsten Direktinvestoren und hat als einziges Land während der Rezession neue US-Stellen geschaffen (siehe den Bericht der Schweizerischen Botschaft). Ausserdem schätzen die USA die diplomatischen Dienste der Schweiz; neben den Schutzmachtmandaten in Kuba und Iran zum Beispiel auch die Mediation zwischen Russland und Georgien im Vorfeld des russischen WTO-Beitritts.
Präsident Obamas Administration wird im Kampf gegen die Steuerhinterziehung keinen Richtungswechsel vollziehen. Barack Obamas Wiederwahlkampagne machte Schweizer Bankkonten für kurze Zeit zum Thema in einem Werbespot. Mitt Romney würde Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, wie er das in seiner Beraterkarriere gemacht habe und wie man das von jemandem erwarten könne, der einen „Swiss Bank Account“ hatte.
Verhärtete Fronten im SteuerdossierDie Schweiz kann sich weiterhin auf harte Forderungen seitens der USA einstellen. Wie kann sie ihre Verhandlungsposition verbessern? Rücksicht auf die schweizerische Rechtslage einzufordern, bringt wenig. Natürlich stimmt es, dass die Schweiz Amtshilfe leistet. Dass Gruppenanfragen noch nicht möglich sind, ist den USA anzurechnen. Senator Rand Paul blockiert das überarbeitete Doppelbesteuerungsabkommen.
In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es keine legitimen Gründe dafür, Geld in der Schweiz anzulegen. Dies könne nur der Steuerhinterziehung dienen. Die Schweiz muss darlegen können, dass Schweizer Konten auch bei korrekter Deklarierung gewinnbringend sind. Diese Nachricht – sobald sie von den Schweizer Banken überzeugend formuliert ist – muss in den USA erst ankommen. Dazu muss die Schweiz dort Gehör suchen, wo dieses zu vermuten ist: bei der Republikanischen Partei. Auch wenn niemand Steuerhinterziehung verteidigt, so gibt es doch Widerstand gegen den Generalverdacht, wie er durch besagten Werbespot geschürt wird.
Etwas Weiteres: das Ausmass des Steuerstreits und seine Bedeutung für die Schweiz sind in der US-Politik weitgehend unbekannt. Schweizer Sorgen interessieren niemanden. Dass Doppelbürger ihre US-Pässe ablegen, weil ihre Konten in der Schweiz geschlossen werden, schon eher.
Was wäre unter Mitt Romney anders geworden?
Wie üblich war die Aussenpolitik kaum Thema im Wahlkampf. Mitt Romneys Positionen sind schwer abzuschätzen. Sicher ist aber, dass sich jeder neue Präsident zuerst orientieren muss – gerade jemand wie Romney, der kaum Vorkenntnisse aufweist. Wahrscheinlich hätte er vor Amtsantritt noch realisiert, dass nicht mehr Russland der „number one geopolitical foe“ der USA ist.
Die Verhandlungen mit der Schweiz hätten sich wahrscheinlich verlangsamt. Zuerst hätten die involvierten Posten in Verwaltung und Justiz grösstenteils neu besetzt werden müssen. Ein Präsident muss gegen 10‘000 Personen per „appointment“ einstellen, über 1‘300 davon bedürfen der Zustimmung des Senats. Unter Mitt Romney wäre der Angriff gegen die Schweizer Banken aber weitergegangen. Der Ton hätte sich vielleicht etwas entschärft – weniger Generalverdacht, mehr Verständnis. In der Sache hätte sich aber kaum etwas geändert, insbesondere wegen der öffentlichen Meinung und dem weiterbestehenden Bedürfnis nach Steuersubstrat.
Ein demokratisch regiertes Amerika ist kooperativer
Ein letzter Punkt, der die Schweiz nicht mehr als andere Staaten betrifft: Die USA treten unter demokratischer Führung kooperativer und kulanter auf. Unter George W. Bush war zum Beispiel der Klimawandel gar kein Thema, unter Barack Obama wurden die Bestrebungen zu einem neuen internationalen Übereinkommen wenigstens wieder aufgenommen. Mitt Romney hätte sich wieder auf den Rückhalt einer Partei verlassen müssen, in der Skepsis und Hohn gegenüber dem Faktum des Klimawandels zum guten Ton gehören.
Präsident Obama muss in seiner zweiten Amtszeit weniger auf Kritik zu Hause achten. Er könnte – ohne auf Wiederwahlchancen angewiesen zu sein – unpopuläre Themen angehen – neben dem Klimawandel auch den US-amerikanischen Umgang mit Menschenrechten. Gerade weil der Kongress weiterhin gespalten sein wird, könnte Barack Obama aussenpolitische Erfolge anpeilen, weil er hier eine freiere Hand hat.
Dominik Elser ist Jurist und lebt in Bern. Im ersten Halbjahr 2012 absolvierte er ein akademisches Praktikum an der schweizerischen Botschaft in Washington D.C.
Der foraus-Blog ist ein Forum, das sowohl den foraus-Mitgliedern als auch Gastautoren/innen zur Verfügung gestellt wird. Die hier veröffentlichten Beiträge sind persönliche Stellungsnahmen der Autoren/innen. Sie entsprechen nicht zwingend der Meinung der Redaktion oder des Vereins foraus.