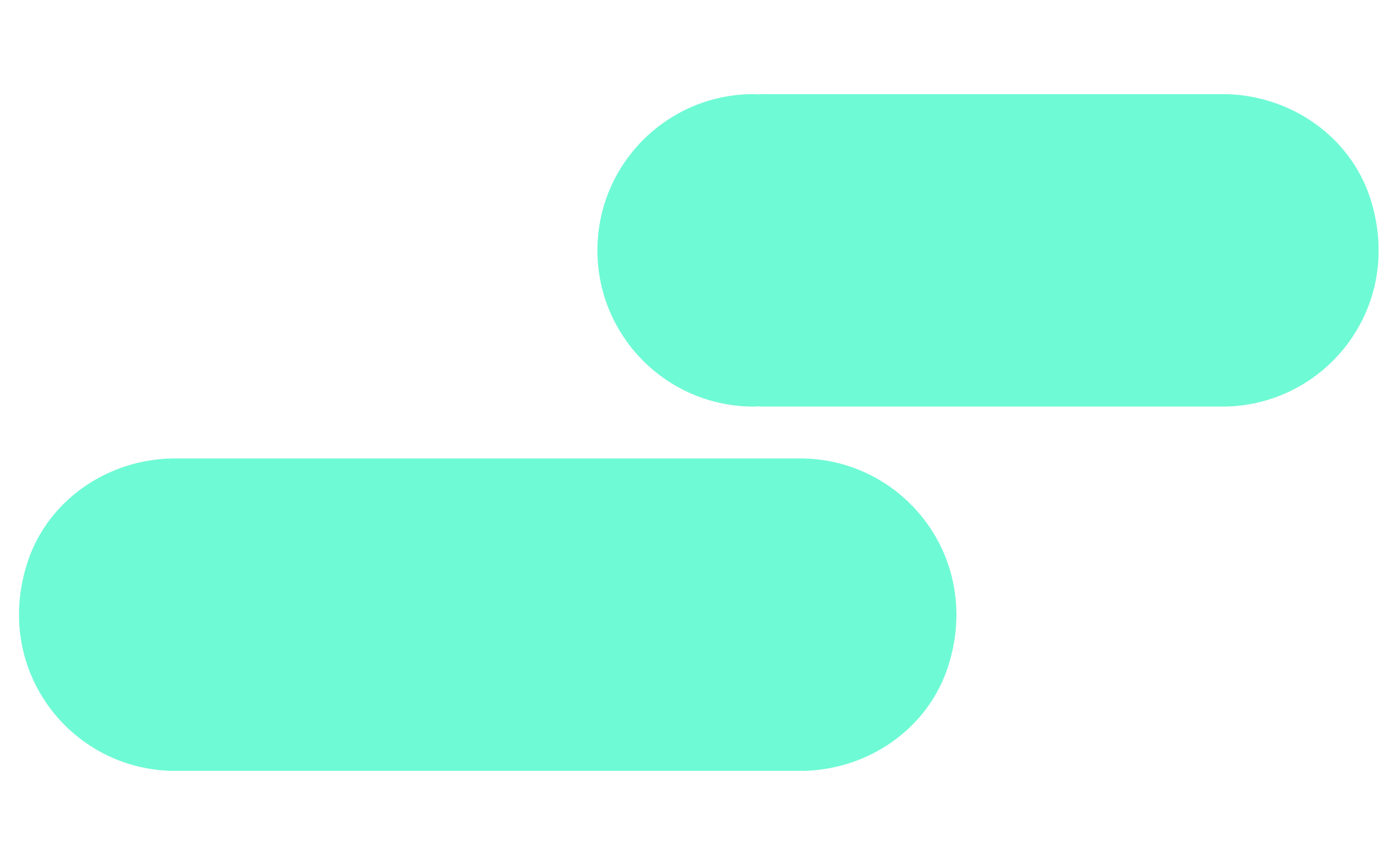Will sich unser Land auch weiterhin als Kleiner unter Grossen und gleichsam als Hochstapler behandeln lassen – oder wollen wir nicht eher der Erste unter den Kleinen sein?
In Europa wie auch in der Schweiz behaupten Befürworter eines schrittweisen EU-Beitritts gern, dass die Schweizer und Europäer die gleichen ethischen und politischen Werte verträten. Indessen hat die Europäische Union eine fundamentale Zielsetzung, mit der die Schweizer ihre Mühe haben: Macht. Das grosse Ziel des europäischen Projekts, das in den Aussagen der EU-Chefs allgegenwärtig ist, besteht nämlich darin, die nötige Grösse sowie die wirtschaftliche, politische und dereinst auch militärische Schlagkraft zu erreichen, die es ihr eines Tages erlauben wird, vermehrt auf die Entwicklung der Welt Einfluss zu nehmen und die europäischen Interessen besser zu verteidigen. Europa will (wieder) eine Grossmacht werden.
Nun ist dies aber genau das Prinzip, gegen das sich die Schweizer immer gewehrt haben und gegen das sich die Schweiz konstituiert hat – mit Höhen und Tiefen zwar, aber auf die Dauer doch mit Erfolg. Die Schweizer haben immer das Recht auf Existenz und Austausch beansprucht, ohne die morbide Suche nach Grösse, Einflusszonen, Allianzen und Unterwerfung mitzumachen. Dieses Prinzip müsste sie eigentlich heute noch leiten, hätte die Schweizer Aussenpolitik nicht den Sinn für die Wirklichkeit ein Stück weit verloren.
Nach dem Ende des Kalten Kriegs wurde oft postuliert, die Welt werde von der Dualität USA/Sowjetunion zu einer multipolaren Konfiguration übergehen. Zu den neuen Polmächten würden die Vereinigten Staaten, Russland, Japan, China, Indien, Brasilien … und vielleicht auch Europa gehören, sofern Deutschland und Frankreich den Rest des Kontinents friedlich einen könnten. Mit anderen Worten: Hat nicht die Stunde der moralischen und kulturellen Überlegenheit Europas geschlagen?
„Friedlich“ heisst nicht: ohne Zwang. Grosse Nationen und Mächte tendieren immer zu einer gewissen Autarkie und Selbstgenügsamkeit, da sie weniger als andere von ihren Handelsbeziehungen abhängig sind. In einer Welt, in der die Suprematie der Waffen durch jene der Wirtschaft abgelöst wurde, ist diese relative Autonomie ein bedeutender Machtfaktor. Es reicht schon aus, wenn die grossen Staaten mehr oder weniger offen damit drohen, dass sie ihren Binnenmarkt verriegeln, um bei den Kleinen die Angst vor einer Isolierung auszulösen – und um von ihnen alles zu bekommen, inklusive die politische Unterwerfung. Auf diesem Weg ist die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, das erweiterte Projekt eines ewigen Friedens zwischen Frankreich und Deutschland (1952), nach und nach zur Europäischen Union geworden. Dies war ein „softes“ Herrschaftsprogramm im modernen Sinn.
Als 1992 die Europäische Union aus dem Maastricht-Vertrag hervorging, war ein ferner Mikro-Staat namens Singapur sehr besorgt ob dieser neuen Supermacht mit unklaren Intentionen. Singapur engagierte sich hierauf für die Schaffung eines informellen Forums der kleinen Staaten im Rahmen der Vereinten Nationen (Forum of Small States FOSS). Dessen offizielle Zielsetzung war sehr allgemein formuliert: Diskussion unter den nicht zu den Grossen gehörigen Staaten der Zukunft. Das inoffizielle Ziel bestand darin, den Grossmächten das Recht der Kleinen auf Unabhängigkeit und Neutralität in Erinnerung zu rufen.
Es gibt keinen dauerhaften Frieden, wenn nicht das Prinzip der Gleichheit der Nationen als Gegengewicht zu den archaischen Macht- und Kräfteverhältnissen garantiert wird. Gleichheit ist hier als Gleichbehandlung zu verstehen, Nation im englischen Sinn als Staat. Dies war ja eines der grossen Ideale des 20. Jahrhunderts. In diesem Sinn kann jeder Staat von einem Partner das verlangen, was dieser einem Drittstaat zugestanden hat (Klausel der meistbegünstigten Nation). Die Tatsache, dass diese moderne Errungenschaft noch nicht komplett umgesetzt wurde, ist kein Grund, um bereits wieder darauf zu verzichten.
Fünfzehn Jahre nach der Gründung der EU nahm der G20 für sich in Anspruch, dass seine Mitgliedsländer mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung vertreten. Damit sollte diesem Kartell der grossen Staaten die nötige demokratische Legitimität (gemäss Mehrheitsprinzip) verliehen werden – umsomehr, als zwei Drittel der europäischen Intellektuellen davon überzeugt sind, dass die Demokratie, die ursprünglich an den Nationalstaat gebunden war, heute nur noch auf weltweiter Ebene einen Sinn hat. Sind die Nationen nicht zum Verschwinden verurteilt? So die Argumentation. Allerdings: die Länder des G20 wollen selbst nichts von Verschwinden wissen, aber die Geschichte ist bekanntlich reich an Widersprüchen und an Doppelbödigkeiten. Es sind immer die Kleinen, die sich sagen lassen müssen, dass die Nation und das Prinzip der Unabhängigkeit keine Zukunft mehr hätten.
Nur zwei Regierungen – jene von Singapur und Norwegen – empörten sich öffentlich über die Neulancierung des G20, eines Projekts, das 1999 entstanden war und das man inzwischen als Totgeburt betrachtete. Machte der G20 aus den Einwohnern von rund 150 kleineren Staaten nicht Weltbürger zweiter Klasse? War dies nicht ein dramatischer Rückfall in den Neo-Imperialismus? Doch der Appel blieb ungehört, vor allem auch in der Schweiz, die ganz damit beschäftigt war, die Enttäuschung zu verarbeiten, dass sie nicht unter den Mitgliedern des G20 figurierte. Warum hätte sie auch darunter figurieren sollen? Der kleinste Staat des neuen Clubs, Saudiarabien, hat immerhin viermal mehr Einwohner.
Doch seit einem Viertel Jahrhundert hat sich die Schweiz in den Kopf gesetzt, dass sie sich wie ein grosser Staat benehmen müsse, weil ihre wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung sie dazu berechtige. Ich erinnere mich an eine Tagung zur Aussenpolitik, die 2010 an der ETH Lausanne stattfand. Damals begann der Botschafter (und künftige Nationalrat) Tim Guldimann, der gleich nach mir sprach, seine Ansprache mit den Worten: „Monsieur Schaller täuscht sich in einem Punkt, der aber sehr wichtig ist: Die Schweiz ist kein kleines Land.“ Was danach kam, zeigte, wie sehr die Illusion von den Grandeur die diplomatische Kultur der Schweiz prägt. Und auch ein Grossteil der öffentlichen Meinung verlangt à tout prix, dass sich die Schweiz vermehrt als grosser Staat präsentiere, der nein sagt, droht und seinen Willen durchsetzt.
Woher kommt diese dramatische Verzerrung der Perspektive? Vermutlich aus einer falschen Interpretation der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 über den Beitritt der Schweiz zum EWR (Europäischen Wirtschaftsraum). Weil wir noch nicht den genügenden Abstand haben, fällt es natürlich schwer, sich hierzu ein abschliessendes Urteil zu bilden; spätere Historiker werden möglicherweise überzeugendere Antworten geben. In der Zwischenzeit fragt man sich aber doch: Wie lange noch will sich die Schweiz als Letzte unter den Grossen und gleichsam als Hochstaplerin behandeln lassen, statt als Erste unter den Kleinen? Eine weitere Folge dieser traurigen Fehleinschätzung und Doktrin: Das FOSS, das 150 Staaten vereint, hat die Schweiz und seine Diplomatie nie richtig interessiert, obwohl sie dem Forum angehört. Die meisten Schweizer wissen nicht einmal, dass es existiert.
Wenn man die Demütigungen betrachtet, die die Schweizer in den letzten Jahren von Seiten der EU hinnehmen mussten (von den Vereinigten Staaten gar nicht zu sprechen), kann man zumindest sagen, dass dieser Approach unserer Aussenpolitik vor allem unsere Machtlosigkeit ans Tageslicht fördert. Sie macht zudem den Eindruck, dass sie nirgendwohin führt, es sei denn in die Isolation – oder zum EU-Beitritt, was einen Grossteil der öffentlichen Meinung der Schweiz verzweifeln lässt. Die anderen europäischen Staaten haben ihre Aussenpolitik dem französisch-deutschen Tandem überlassen, ohne zu wissen, was dieses vorhat. Finden wir dies eine beneidenswerte Option? Sind diese Staaten vor Schikanierungen seitens Berlin, Paris, Brüssel und Washington geschützt? Man hat nicht immer diesen Eindruck.
Die derzeitigen guten Beziehungen der Schweiz zu China und Russland sollten uns auch nicht zu Illusionen verleiten. Es wird nie möglich sein, aus ihnen eine Allianz gegen die wirtschaftliche Kanonenbootpolitik der EU zu schmieden. Denn eine solche würde auf Unverständnis stossen, besonders in der Schweiz. Wäre darum nicht der Moment bekommen, um sich zu fragen, was wir zusammen mit 150 kleinen und mittelgrossen Staaten dieser Welt unternehmen könnten? Die Schweiz stellt ausserhalb der EU, der Nato und des G20 nichts Besonderes dar. Deshalb sind diese kleinen und mittelgrossen Staaten ganz eindeutig ihre natürlichen Verbündeten gegenüber den grossen Staaten. Diese warten nur darauf, die Kleinen unter sich aufzuteilen und sie zu zwingen, sich für das eine oder andere Lager zu entscheiden. Führt nicht Machtpolitik im Allgemeinen zu solcher Konfrontation?
Es stimmt zwar, dass das FOSS keine Länder mit mehr als 10 Millionen Einwohnern aufnimmt, was als klar zu restriktiv erscheint. Und es trifft zu, dass das Forum nicht sehr aktiv ist, was zweifellos auf einen Mangel an Leadership zurückzuführen ist. Singapur ist ein Stadtstaat, der ein zu spezielles Profil aufweist, um die Führungsrolle überzeugend zu spielen und für Ausstrahlung zu sorgen. Ganz anders die Schweiz: Sie gehört bezüglich Einwohnerzahl weltweit zur Mittelklasse und verfügt über eine grosse wirtschaftliche Diversifizierung, eine lange diplomatische Vergangenheit, ein grosses Renommee sowie ein gewichtiges Kapital an Sympathie.
Ausserdem liegt kein anderer Kleinstaat mitten im geographischen Herzen der EU. Diese besonders unbequeme Besonderheit verleiht aber der Schweiz einen grossen symbolischen Wert. Nur indem die Europäer die Schweiz als Nicht-Mitgliedstaat vollumfänglich respektieren, ohne sie permanent des unlauteren Wettbewerbs zu bezichtigen und sie mit Repressalien und Vergeltungsmassnahmen zu bedrohen, kann die EU beweisen, dass sie nicht eine neue triviale, rückwärtsgewandte und imperialistische Macht ist. Und nur so kann sie von sich behaupten, nicht wie andere Mächte vor ihr mit Klientelenwirtschaft, Einflusszonen und schwarzen Listen zu agieren. Die Schweiz ist für die EU zu einer Art moralischem Test geworden, der weltweit beachtet wird. Dabei wird die Schweiz a priori positiv gesehen. Wenn die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz schlecht sind, wird niemand annehmen, dies sei unserer Arroganz geschuldet.
Natürlich ist es klug und wichtig, mit allen dominierenden Mächten gute Beziehungen zu unterhalten. Kleine Staaten müssen sich immer mit den Grossen arrangieren, aus eigener Kraft, ohne auf fremde Hilfe zu zählen. Auch müssen sie akzeptieren, dass diese Beziehungen selten zu ihrem Vorteil sind. Es geht also nicht darum, die kleinen Staaten gegen die grossen aufzustacheln, denn dies wäre sicher schlecht für Erstere. Das permanente und energische Einfordern des Gleichheitsprinzip unter Staaten zugunsten des Friedens und des allgemeinen Wohlstands wäre keine Ersatzstrategie, sondern ein Kampf, der parallel und komplementär geführt werden müsste, besonders über Mediatisierung und Vermittlungstätigkeit.
Die Schweiz hat in diesem Bereich eine wichtige Rolle zu spielen, wahrscheinlich sogar eine Führungsrolle. Und dies je nach Aktualität, wenn Staaten und Machtblöcke ihre dominierende Position missbrauchen. Diese müssen offengelegt werden. Dabei müssen die öffentlichen Meinungen für die Gleichheit zwischen den Staaten sensibilisiert werden, damit der schöne Begriff Multipolarität nicht auf neue unkontrollierbare Abenteuer hinausläuft.
Es gibt viele Wege, wie man dies tun kann, mit oder ohne FOSS. Man könnte beginnen, indem man aus der Förderung der Gleichheit zwischen den Staaten die erste und sichtbare langfristige Priorität unserer Aussenpolitik macht – und zwar unter Einbezug privater Initiativen. Weshalb nicht das Forum von Davos, das immer mehr hustet, weil es nur noch den Zeitgeist atmet, daran beteiligen? Könnte Davos nicht auf das grosse und weite Thema der Beziehungen zwischen Grossmächten und kleinen und mittelgrossen Staaten ausgerichtet werden, wobei beide Seiten zu Gesprächen geladen sind? Beispielsweise könnten spezifische und subsidiäre Verfahren der Arbitrage und der Konfliktsbewältigung entwickelt werden. Denkbar wäre auch die Schaffung eines Observatoriums, das die ungleiche Behandlung des Souveränitätsprinzips im Fokus hätte. Dieses sollte auch die Aufbereitung jener Fälle sicherstellen, in denen grosse Staaten die Regeln und Zwänge nicht respektieren, die anderen im Namen des Friedens und der Gerechtigkeit auferlegt werden; denkbar wären Jahresberichte nach dem Modell gewisser NGOs. Man könnte auch regelmässig einen Preis verleihen, so wie Norwegen jährlich einen Friedensnobelpreis ausrichtet. Dies wäre ein gutes Mittel, um sich beiläufig auch Freunde auf den fünf Kontinenten zu schaffen.
Wenn die Vereinigten Staaten und die EU ein wichtiges Wirtschaftsabkommen abschliessen (ohne Personenfreizügigkeit), so scheint es normal, dass bescheidenere Staaten sich bei ihnen versichern, dass dieses nicht zu ihrem Nachteil ist. Und dass sie schauen, unter welchen Bedingungen sie in einem späteren Zeitpunkt daran teilnehmen können. Es ist auch naheliegend, dass sie sich vergewissern, wie weit das Prinzip der meistbegünstigten Nation zur Anwendung gelangt. Falls dies nicht der Fall ist, sollten die Dinge zumindest klar auf dem Tisch liegen, damit allfällige Unstimmigkeiten öffentlich benannt und allenfalls feierliche Proteste eingelegt werden können.
Selbstverständlich ist nicht alles schlecht an der heutigen Aussenpolitik der Schweiz. Aber was in beunruhigendem Mass fehlt, ist ein Blick von hoher Warte sowie Tiefgang und guter Orientierungssinn – alles Dinge, die eigentlich nur vom Parlament kommen können. Was fehlt, ist eine Geisteshaltung, die ungünstige Umstände pragmatisch dazu nutzt, um ein Ideal zu alimentieren und zu fördern, das sie trägt und ihr entspricht – ein Anliegen, das ihr eine Ausstrahlung bringt, die sie selbst erarbeitet hat, wenn auch in Zusammenarbeit mit anderen, zur Zeit vielleicht weniger betroffenen Staaten. Die Schweiz würde sich schnell weniger einsam fühlen. Die Rolle eines sekundären Staates, der die Rolle eines Wächters der Kleinen übernimmt, würde ihr auch mehr Respekt seitens der grossen Mächte einbringen. Wir denken dabei vor allem an die Europäische Union und an die Vereinigten Staaten, die dann nicht mehr im gleichen Mass wie heute auf die immense Orientierungslosigkeit der Schweiz zählen könnten.