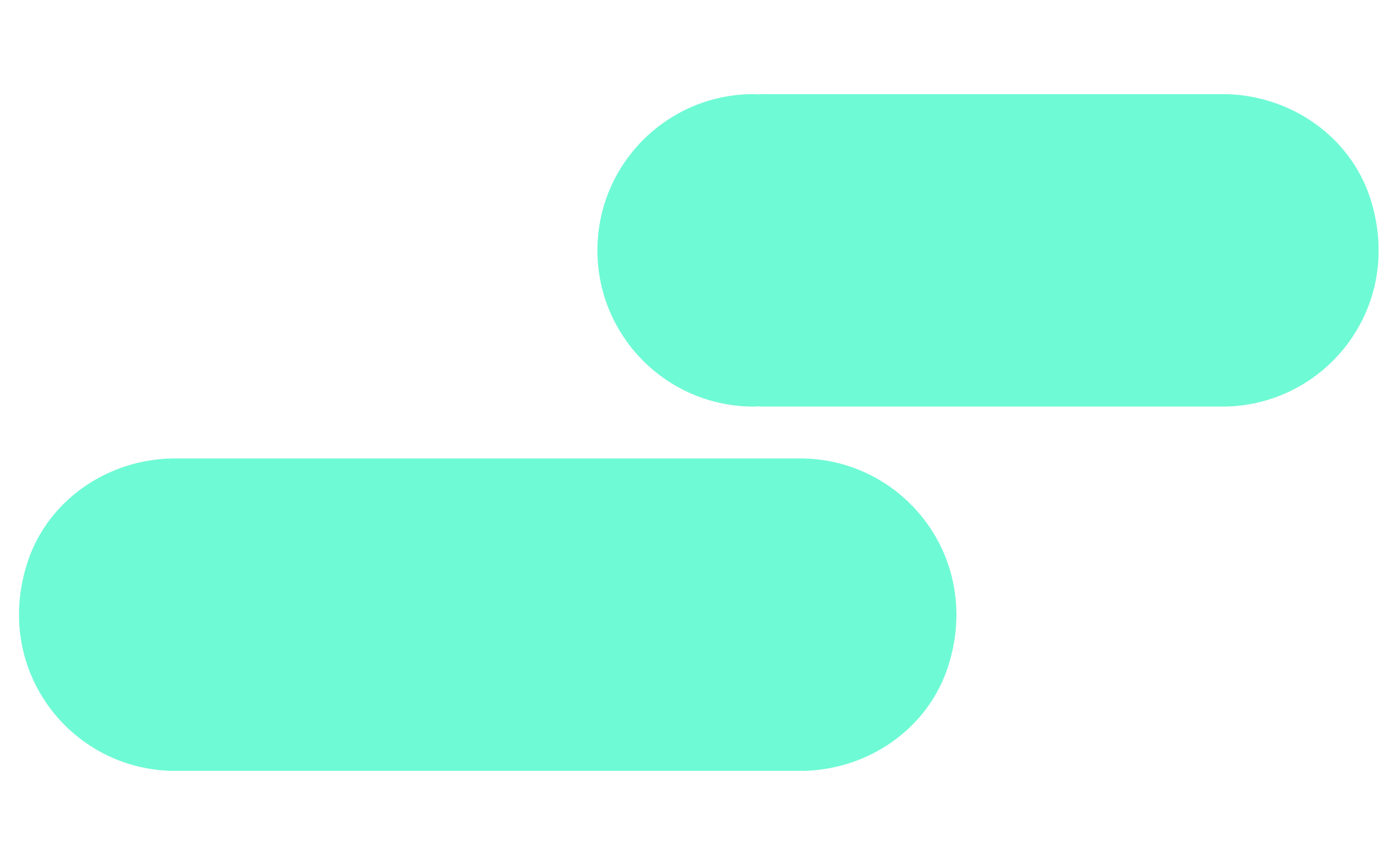China produziert über 40 Prozent der Autos weltweit, während der Anteil Europas auf 18 Prozent gesunken ist. Schweizer Zulieferer sind dem deutschen Automobilsektor ausgesetzt, der seine Produktion und seine Lieferketten nach China verlagert. Europa und die Schweiz sollten reagieren und die Förderung des Sektors mit lokaler Wertschöpfung verknüpfen.
Wie chinesische Industriepolitik den Automobilsektor umpflügt
Wer heute durch Zürich, Berlin oder Amsterdam geht, sieht nur wenige eAutos und kaum solche aus China. Doch dieser Eindruck täuscht, denn der eigentliche Wandel findet global statt. China hat sich zum führenden Akteur der Elektromobilität entwickelt. Industriepolitik war international lange geächtet und kehrt nun auf die weltwirtschaftliche Bühne zurück. Offene Volkswirtschaften spüren zunehmend, wie teuer Offenheit sein kann. Um das Jahr 2000 produzierte Europa noch über ein Drittel aller Autos weltweit, China fast keine. Bis 2024 stieg Chinas Anteil auf über 40 Prozent, während Europas Anteil auf die Hälfte des früheren Niveaus fiel.
Chinas Aufstieg ist jedoch nicht das Ergebnis von Marktkräften. Als klar wurde, dass China in der Herstellung von Verbrennungsmotoren nicht mit Europa mithalten konnte, sprang Peking direkt auf den Zug der Elektromobilität auf. Seit 2009 hat die chinesische Regierung rund 230 Milliarden Dollar Subventionen vergeben, verknüpft mit der Bedingung lokaler Produktion. Die chinesische Automobilindustrie profitierte davon. Ein Beispiel sind die Batteriehersteller. Nur diejenigen, die vom Industrieministerium genehmigt wurden, konnten die Subventionen in Anspruch nehmen und sich so ohne ausländische Konkurrenz entwickeln. Batterien machen etwa 30 bis 50 Prozent des Gesamtwerts eines eAutos aus und bestehen hauptsächlich aus Lithium und Kobalt. Bis 2024 hatte China über die Hälfte des weltweiten Angebots dieser Rohstoffe raffiniert und etwa 85 Prozent aller Batteriezellen hergestellt.
Der globale Automobilmarkt ist kein Nullsummenspiel. Neue Hersteller aus verschiedenen Ländern fordern die etablierten Marken heraus. Japan und Südkorea schützten in den 1970er und 1980er Jahren ihre Automobilindustrie, öffneten sich jedoch schrittweise dem internationalen Handelsregime. Europa hat sich angepasst, um wettbewerbsfähig zu bleiben. China hingegen spielt nach seinem eigenen Regime. Offene Volkswirtschaften müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie reagieren sollen, ohne sich abzuschotten.
Die unzureichende Reaktion Europas
Ende 2024 hat die Europäische Kommission Zölle auf chinesische eAutos eingeführt. Unterstützt nur von einer knappen Mehrheit der Mitgliedsstaaten. Die Idee war, dass die Einfuhrzölle die Subventionen ausgleichen sollten, die einzelne Unternehmen – auch europäische Hersteller – erhalten. Die deutsche Automobilindustrie hat sich jedoch stark gegen die Zölle ausgesprochen. Warum sollten Europas grösste Autohersteller ihre subventionierten Konkurrenten schützen? Weil China bei der Elektromobilität führend ist und dank eigener Lieferketten günstiger produziert. Ein in China gebautes eAuto kostet etwa ein Drittel weniger als ein in Europa produziertes. Deutschen Unternehmen wollen Zugang zu diesem Ökosystem.
Die deutschen Autohersteller sagen, sie produzierten in China nur für den chinesischen Markt. In Wirklichkeit bauen sie aber für den Weltmarkt, mit Ausnahme der USA. 2020 hielten deutsche Autohersteller und Zulieferer in China rund 30 Milliarden US-Dollar in Form von ausländischen Direktinvestitionen (FDI).
Ein Jahr später fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die EU-Zölle haben die Importe kaum gebremst und zugleich die Staatengemeinschaft gespalten. Die Episode zeigt Europas Schwäche: In einer Welt, die per Dekret handelt, reagiert die EU zu langsam und zu formalistisch.
Das Thema ist zentral, denn die Automobilindustrie bleibt bedeutender Wirtschaftszweig. Sie steht für 7 Prozent des EU-BIP und beschäftigt in der Schweiz über 34 000 Personen. Mehr als 600 Schweizer Unternehmen beliefern europäische Hersteller mit Fahrzeugteilen und Materialien.
Schweizer Abhängigkeit von Deutschland
Die Schweiz sollte nicht untätig bleiben. Die Schweizer Zuliefererindustrie ist eng mit den Entscheidungen der deutschen Automobilindustrie verknüpft. Rund drei Viertel der Schweizer Automobilzulieferer exportieren nach Deutschland, und ein Viertel der Schweizer Automobilzulieferer ist für mehr als die Hälfte ihres Umsatzes auf Deutschland angewiesen. Audi, BMW und Mercedes-Benz sind ihre Hauptkunden. Wenn die Produktion in Deutschland in Richtung China verlagert wird, droht vielen Schweizer Zulieferern der Verlust ihrer Marktposition.
Die EU und die Schweiz sollten Chinas Strategie gemeinsam analysieren, ohne deren Protektionismus zu übernehmen. Subventionen für Elektrofahrzeuge und Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollten an lokale Produktion gebunden werden. Ebenso braucht es Vorgaben, wonach in Europa verkaufte Fahrzeuge einen Mindestanteil lokal produzierter Teile enthalten müssen. Umgekehrte Joint Ventures könnten zudem helfen, von chinesischen Herstellern wie BYD zu lernen. Auch das öffentliche Beschaffungswesen sollte in der Lage sein, nach Hersteller zu diskriminieren. Die Schweiz darf nicht darauf vertrauen, dass andere diese Arbeit für sie übernehmen.
Jetzt ist der Moment für Schweizer Unternehmen, ihre Kundenbasis zu erweitern und ihre Forschungskooperationen zu vertiefen. Vielleicht erzählen die Strassen in Zürich, Berlin oder Amsterdam dann eine andere Geschichte. Eine Geschichte eines Europas, das wieder zu konkurrieren gelernt hat – mit Schweizer Zulieferern, die Teil einer stärkeren, saubereren und eigenständigeren Automobilindustrie sind.