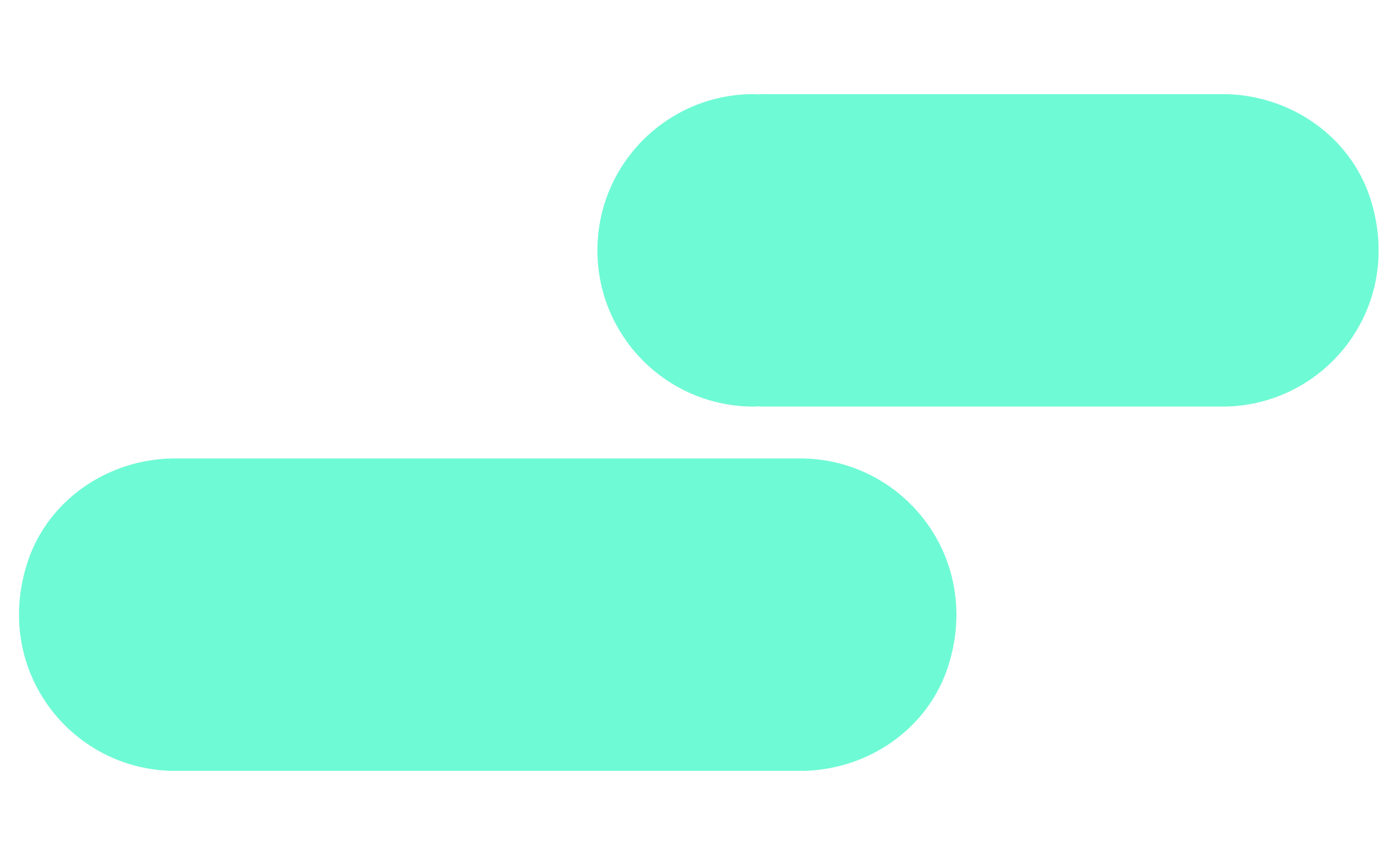Schottland sagt «naw» zu einem mit vielen Fragezeichen gepflasterten Weg in die Unabhängigkeit. Restbritannien ist erleichtert. Bleibt nun alles beim Alten? Mitnichten.
Grosse Erleichterung herrscht bei den britischen Gewerbetreibenden: Englische Metzger können die Überreste der Schaffleischverarbeitung weiterhin gewinnbringend als Rohmaterial für das schottische Nationalgerichtverkaufen, Spielwarenverkäufer können für das Weihnachtsgeschäft weiterhin auf den Mädchenklassiker Einhorn setzen, ohne subversiv separatistische Handlungen befürchten zu müssen, und Grafikern bleibt die Frage erspart, wie man das schottische Andreaskreuz aus dem «Union Jack» entfernt, ohne ein visuelles Desaster anzurichten. Auch die Frage, wie man das Vereinigte Königreich ohne das schottische Königreich – welches neben England das einzige Königtum im Bunde ist – denn nun nennen würde, ist vorerst vom Tisch.
Über die Gründe für die Ablehnung des schottischen Unabhängigkeitsreferendums kann im Moment nur spekuliert werden. Hat der in den USA wirkende englische Talkmaster John Oliver mit seinem Tanz mit dem Einhorn zu Dudelsackmusik möglicherweise den Ausschlag gegeben? Oder waren die pro-Unabhängigkeitskatzen aus Russland einfach nicht süss genug? Auf eine detaillierte, seriöse Nachwahlanalyse müssen wir jedenfalls ziemlich sicher verzichten. Denn vor allem aus finanziellen Gründen versäumten es die grossen britischen Medienhäuser, die sonst bei Wahlen und Abstimmungen üblichen „Exit Polls“ zu erheben.

Wehen weiterhin gemeinsam im Wind: Schottisches Andreaskreuz und der britische Union Jack in Edinburgh (Quelle: Wikimedia Commons, Andy Dag, Lizenz)
Klar ist jedoch bereits heute: Auch wenn die schottischen Stimmbürger Grossbritannien vor einer schmerzhaften Scheidung inklusive schmutzigem Rosenkrieg bewahrt haben, steht der grossen Insel nun eine lange Paartherapie mit einschneidenden Veränderungen im Ehevertrag bevor. Die Zugeständnisse, welche die britische Politelite den Schotten im Falle einer Ablehnung des Referendums versprochen hatte, gilt es nun rasch in die Praxis umzusetzen: Während Schottland nun von Westminster grössere politische Autonomie und somit mehr Selbstbestimmung erhalten soll, verbleibt das restliche Grossbritannien im bisherigen, strikt unitarischen System, das zwischen lokaler und der nationaler Ebene kaum Raum für föderale Strukturen bietet. Verfassungsjuristen sind nun also gefordert, für diesen Widerspruch eine verträgliche Lösung zu finden. Schlussendlich läuft es wohl darauf hinaus, dass auch den restlichen drei britischen Nationen Nordirland, Wales und England ein gewisser Grad an politischer Autonomie gewährt werden soll.
Aus Sicht eines Schweizers, dem das Subsidiaritätsprinzip sozusagen mit der Muttermilch eingeflösst wurde, liegt es nahe, eine britische Dezentralisierungstendenz zu unterstützen, damit politische Entscheidungen auf derjenigen Ebene geschehen, wo sie am nächsten liegen. Die schrittweise Föderalisierung eines jahrhundertelang zentralistisch regierten Systems wird jedoch bestimmt nicht einfach und noch für viele schreiende Voten im britischen Parlament sorgen. Es wird spannend!