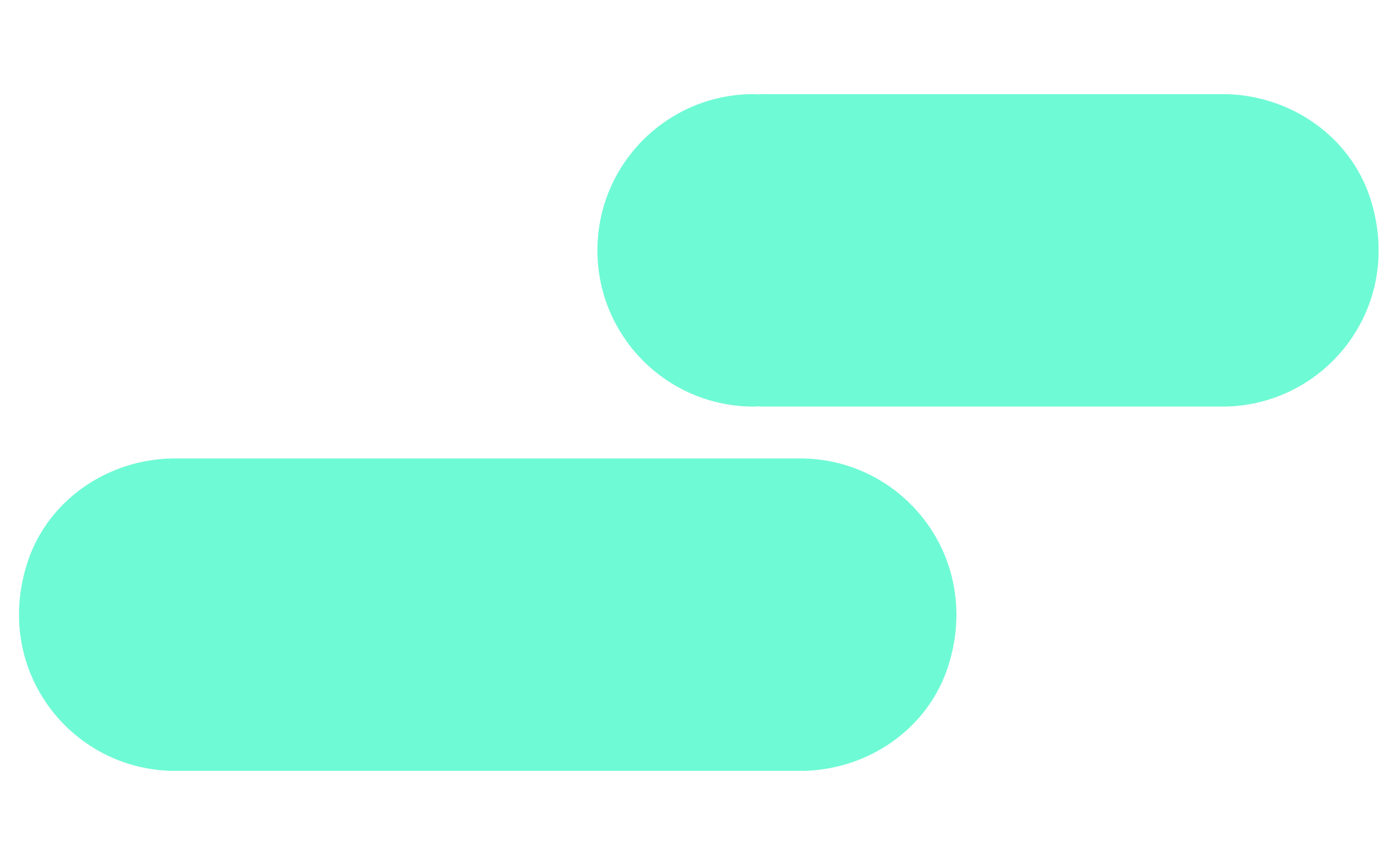Die Beendigung der Personenfreizügigkeit verursacht Verdiensteinbussen für jene, die dadurch nicht mehr in die Schweiz migrieren können. Wäre die Schweiz bereit, diesen Schaden zu ersetzen, könnte die EU eigentlich nichts gegen ein Ende der Personenfreizügigkeit einwenden.
Die rhetorische Vorbereitung der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU um die Zukunft der Personenfreizügigkeit war bisher beiderseits geprägt vom Appell an grosse Prinzipien: Die nationale Souveränität und das darin enthaltene Recht, die Zuwanderung „eigenständig zu steuern“, ist der Appell, der in der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) enthalten ist. Das „unverrückbare europäische Grundprinzip des freien Personenverkehr“ ist der prinzipielle Standpunkt der EU.
Beide Prinzipien sind ein Bluff. Die Schweiz hat spätestens mit dem Italienerabkommen von 1965 davon abrücken müssen, die Zuwanderung eigenständig zu steuern und die EU macht bei der Personenfreizügigkeit Ausnahmen, wenn das ihren Interessen entspricht.

Hinter der prinzipientreuen Rhetorik verbirgt sich eine ökonomische Ratio: Die Schweiz hat mit den Bilateralen I den partiellen Zugang zum gemeinsamen Markt der EU für einen Freundschaftspreis erstanden. Der Preis, den sie bezahlte, war im Wesentlichen die Personenfreizügigkeit. Nun möchte die Schweiz diesen Preis zurück, aber den Zugang zum Binnenmarkt behalten. Oder bildlicher: Sie möchte den Fünfer zurück, aber das Weggli behalten, das sie 2002 zu reduziertem Preis erstanden hatte.
Eine eigentlich offensichtliche Lösung
Mit diesem Anliegen wird die Schweiz scheitern, das ist klar. Vom Blickwinkel der ökonomischen Interessen aus betrachtet wird aber auch klar, welche Strategie funktionieren könnte: Die Schweiz möchte ihre Zuwanderung „eigenständig“ Steuern, worunter die MEI einen „Vorrang für Schweizerinnen und Schweizer“ und jährliche Kontingente versteht. Diese sollen zu einer Reduktion der Zuwanderung führen. Die EU will nicht um den Preis gebracht werden, zu dem sie mit der Schweiz seinerzeit handelseinig geworden war. Der eigentlich offensichtliche Weg das Problem zu lösen lautet: Die Schweiz entschädigt die EU oder (besser noch) deren Bürgerinnen und Bürger, die einen Schaden davon haben, dass sie ihre Arbeitskraft nicht mehr in der Schweiz anbieten dürfen.
Die Schweiz besser, die EU nicht schlechter
Der Schaden, den die Schweiz den EU-Bürgern gegenüber verursacht, besteht in der Verdiensteinbusse, die sie erleiden, wenn sie nicht in der Schweiz arbeiten können, obwohl sie hier eigentlich eine Stelle gehabt hätten. Der Schadensfall tritt ein, wenn die Kontingente voll sind oder ein Inländer vorgezogen werden muss. Dieser Schaden ist nicht nur sehr konkret, sondern auch verhältnismässig einfach zu berechnen. Er besteht aus dem Kapitalwert der Differenz zwischen den Einkommensüberschüssen, die jemand in der Schweiz hätte erzielen können und den Einkommensüberschüssen, die im europäischen Ausland erzielt werden können. In der Berechnung solcher Schäden aus Einkommensausfällen haben Gerichte grosse Erfahrung. Einer Person den Zugang zu einer Stelle zu verweigern ist ökonomisch vergleichbar damit, eine Person so zu verletzen, dass sie nicht mehr voll arbeitsfähig ist. Auch der Schaden kann daher vergleichbar errechnet werden. Etwas kniffliger wird die Berechnung des Schadens für die Familie, die entweder nicht in die Schweiz migrieren kann, weil ein Arbeitnehmer abgewehrt worden ist, oder weil dieser seine Familie nicht mehr nachziehen kann. Vielleicht gelänge es, sich mit der EU in diesen Fällen auf Pauschalen, oder auf ein standardisiertes Berechnungsverfahren zu einigen.
Macht die Schweiz plausibel, dass sie gewillt ist, den vollen Schaden auszugleichen, so läge eine Lösung vor, welche die Schweiz besser stellt (gemäss ihren eigenen politischen Präferenzen) und die EU nicht schlechter stellt. Es wäre eine pareto-optimale Lösung. Nicht einmal politische Einwände könnte die EU dagegen haben, denn diese Lösung würde allen EU-Mitgliedstaaten, die ihrerseits gerne die Personenfreizügigkeit einschränken wollen, vor Augen führen, wie teuer der Schadensersatz für dieses Verhalten ist.
Migrationspolitik auf eigene Rechnung
Die Schweiz hingegen hätte, was ihre Bevölkerung sich wünscht: Inländervorrang und Kontingente und trotzdem noch partiellen Zugang zum Binnenmarkt. Es wäre eine Möglichkeit, das Nullsummenspiel zu überwinden, das ein bald erscheinendes foraus-Diskussionspapier bei der Umsetzung der MEI konstatiert. Je kleiner die Schweiz die Kontingente ansetzt, desto mehr EU-Bürger wird sie abweisen. Je gestrenger sie das Kriterium des Inländervorranges anwendet, desto öfter ginge Hochwohlgeborenheit vor Eignung für einen Job. Beide Instrumente würden den Schadensersatz nach oben treiben. Ökonomisch gesprochen würde dieser Schadensersatz dazu führen, dass die Schweiz die negativen Externalitäten, die sie durch Aussperrung aus dem Arbeitsmarkt verursacht, internalisieren muss. Sie wird dadurch nur jene Zuwanderung abwehren, deren Abwehr ihr mehr Wert ist, als den Abgewehrten die Zuwanderung in die Schweiz. Wenn das System des Schadensersatzes richtig funktioniert, dann führt dies dazu, dass die Schweiz genauso viel Zuwanderung verhindert, wie dies gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist. Gut möglich, dass die Schweizer Politik zum Schluss kommt, wenn sie die Zuwanderung auf eigene Rechnung reduzieren müsse, dann habe sie gar kein Interesse an einer Reduktion der Zuwanderung.