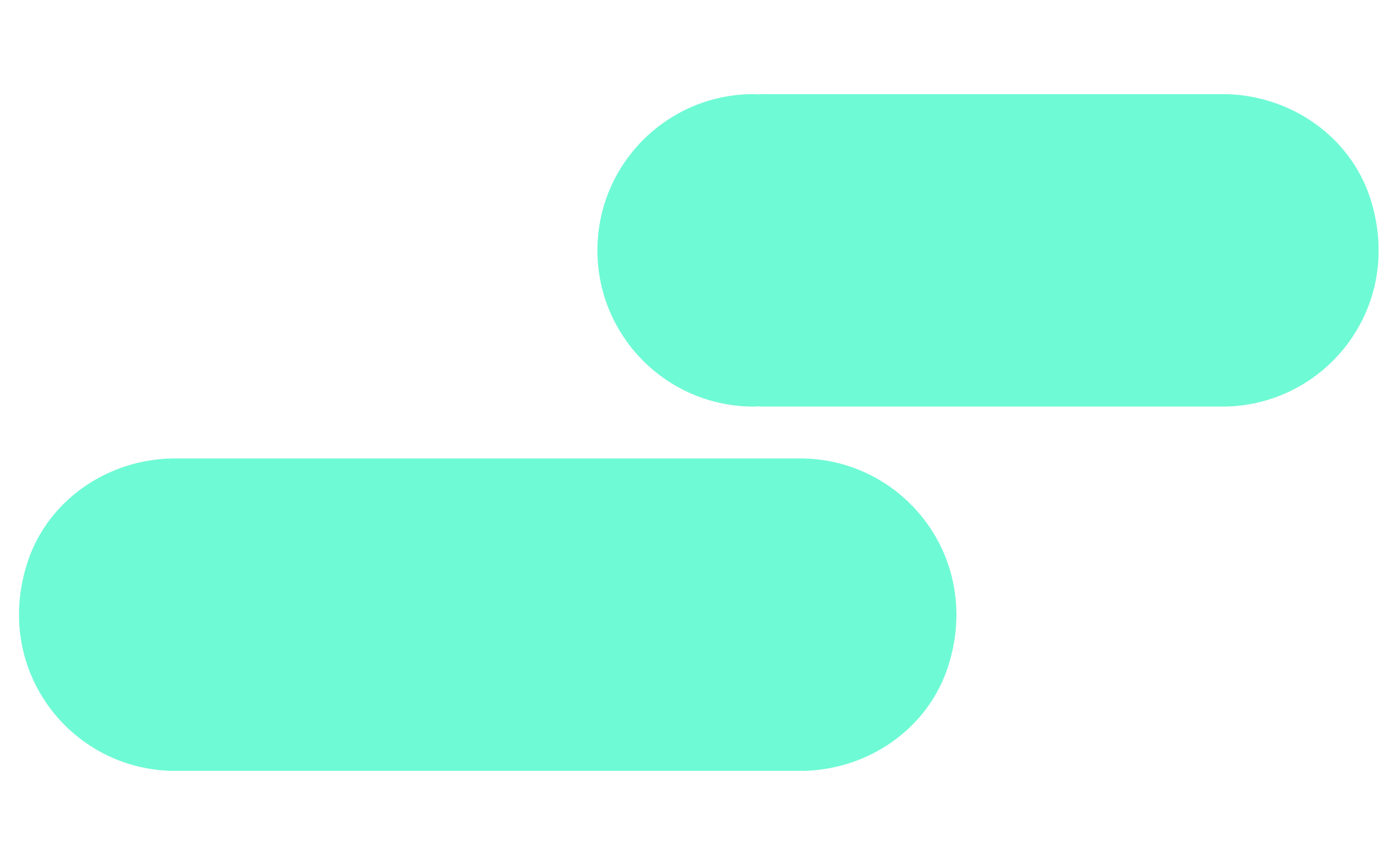Im bisherigen Streit um die Börsenäquivalenz hat die Schweiz in den Augen vieler als gewiefter David gegen einen übermächtigen Goliath geglänzt. Anders als in Legenden ist es mit einem Steinwurf aber nicht getan. Die Schweiz täte besser mit offenem Visier anzutreten und für sich zu klären, wie sie im Verhältnis zu Europa stehen will – bereits am 27. September folgt die nächste Probe aufs Exempel.
Punktsieg in der ersten Runde
Seit dem 30. Juni 2019 untersagt die Europäische Kommission europäischen Händlern und Anlegern, am Börsenplatz Schweiz Aktien zu kaufen oder verkaufen. Vordergründig geht es dabei um den Schutz der 2018 verschärften Finanzregularien (MiFID II); konkret war es ein Warnschuss an die Schweiz, mit dem Rahmenabkommen ihre Beziehung zur EU neu aufzugleisen. Der Bundesrat reagierte am Folgetag postwendend. Aus seinem Handelsverbot für Schweizer Aktien auf Auslandsbörsen entstand abseits des Verhandlungspokers die heutige Pattsituation an der Börse: Aktieninteressenten aus der EU müssen die Schweiz umschiffen, obwohl Schweizer Aktien an EU-Börsen nicht mehr zugelassen sind.
Börsenunternehmen und Makler*innen in der Schweiz konnten sich vorerst freuen: das erste Ergebnis war eine Verschiebung der Handelsaktivität nach Zürich, zumindest bei Titeln grosser Firmen. Bei KMU-Aktien hingegen stiegen laut US-Wirtschriftenhändler Virtu Financial die Handelskosten zwischenzeitlich um 20% auf den beobachteten Börsen und Handelsplätzen, was auf Eiszeitstimmung in diesem Marktsegment schliessen liess.
Bedeutender ist die beeindruckende Zunahme des nicht-regulierten «Schattenhandels» auf den sogenannten Over-The-Counter (OTC) Plätzen. Obwohl diese Handelsform schon seit Jahren wächst, ist der Umsatz in den von der SIX Group beobachteten «Dark Books» ab Juli 2019 gerade von ca. 2,5 Mia. CHF im Vormonat auf über 8 Mia. CHF explodiert (siehe Grafik).
Die Aktienhändler können die Barrieren (noch) leicht umgehen. Dem Bundesrat ist mit seinen Gegenmassnahmen ein Manöver gelungen, das selbst auf der Gegenseite beklatscht wurde. Was das heisst, brachten deutsche Retailbanken Ende 2019 dann auf den Punkt: Der Schuss, mit dem die EU die Schweiz von ihrer «Hinhaltestrategie» abbringen wollte, ging nach hinten los.
Im Worst-Case drohen ernste volkswirtschaftliche Engpässe
Man könnte jetzt davon ausgehen, dass sich diese gegensätzlichen Entwicklungen im Aktienmarkt auf Dauer in Wohlgefallen auflösen und die EU die Schweiz trotz blauem Auge davonkommen lassen wird. Aber realistisch gesehen haben (potentielle) Aktionär*innen schweizerischer Mittelstandsfirmen – also jene, die den Aktienmarkt am meisten benötigen – bereits klargemacht, dass solche Unternehmen ausländische Risikoteilnehmer*innen brauchen. Das wird auch die europäische Kommission mit Genugtuung registriert haben. Damit wurde für die EU in Zeiten von Brexit und autokratischen Anfechtungen im Osten des Kontinents ein wunder Punkt offengelegt.
Aus Ländern mit weniger entwickelten Kapitalmärkten ist bekannt, dass bei solchen Finanzierungslücken entweder lokale Banken oder Grossanleger*innen in die Bresche springen müssen. Beides hätte das Dilemma zur Folge, dass sich mehr Schweizer*innen am Risiko von Schweizer*innen beteiligen. Seit der Finanzkrise sind die Risikoanforderungen an Banken gestiegen, so dass sich laut SECO-Studie aus 2016 viele KMUs ein Kreditgesuch bei einer Bank gar nicht erst zutrauen. Bereits heute besteht ein Grad der Unterversorgung, den Volkswirt*innen als «Funding Gap» bezeichnen. Und auch die Pensionskassen können nicht unbegrenzt schweizerische Aktien kaufen. Zwischen 10-15% machten diese in den letzten Jahren in deren Portfolios aus, weit über dem Gewicht der Schweiz im weltweiten Aktienmarkt.
Der Showdown ist unvermeidlich
Es springt für die Schweiz kaum etwas dabei heraus, wenn sie weiterhin versucht, die EU weiter vorzuführen. Die Anpassungsfähigkeit des freien Marktes hat die Schweiz bisher gerettet, doch gerade hier droht gegen die in Finanzregulierung umtriebige EU langfristig ein einsamer Pyrrhussieg.
Immer wieder seit der EWR-Abstimmung bekundete die Schweiz ihren Willen, mit der EU intensiv zu handeln, aber keinesfalls durch ständige Übernahme von EU-Recht die eigene Souveränität aufgeben zu wollen. Für die Europäische Union hingegen sind die Handelsprivilegien, die die Schweiz in den letzten Jahrzehnten genoss, eine Sache ihrer Souveränität. Es führt also kaum ein Weg daran vorbei, dass das Parlament oder letztendlich gar der Souverän selbst in einer Abstimmung ein für alle Mal festhält, wie bzw. zu welchen Bedingungen man mit der EU Handel treiben will.
Als Alternative bliebe eine Auseinandersetzung auf handelsrechtlicher Ebene – so wurde schon ein Schlichtungsverfahren in der Welthandelsorganisation (WTO) angedacht. Da die Verleihung des Äquivalenzstatus ein politischer Entscheid ist, wäre das kein undenkbarer Vorgang. Nur wird dem Bundesrat wohl bewusst sein, dass ein solches Vorgehen auch ungewollte Konsequenzen für seine Gegenmassnahmen mit sich bringen könnte.
Egal ob die Schweiz die Stunde der Wahrheit schneller herbeiführen möchte oder nicht – wir sind längst in einer Verhandlungsphase angekommen, in der das Thermometer der EU empfindlich auf jede politische Willensbekundung reagiert. Sollte das Pendel in Richtung Abschottung ausschlagen, wird die EU entsprechend reagieren. Wir können uns trotz aller Unsicherheiten über die Lager hinweg gewiss sein, dass das auch für die Abstimmung über die Begrenzungsinitiative am 27. September gilt.
Photo: Pxhere.