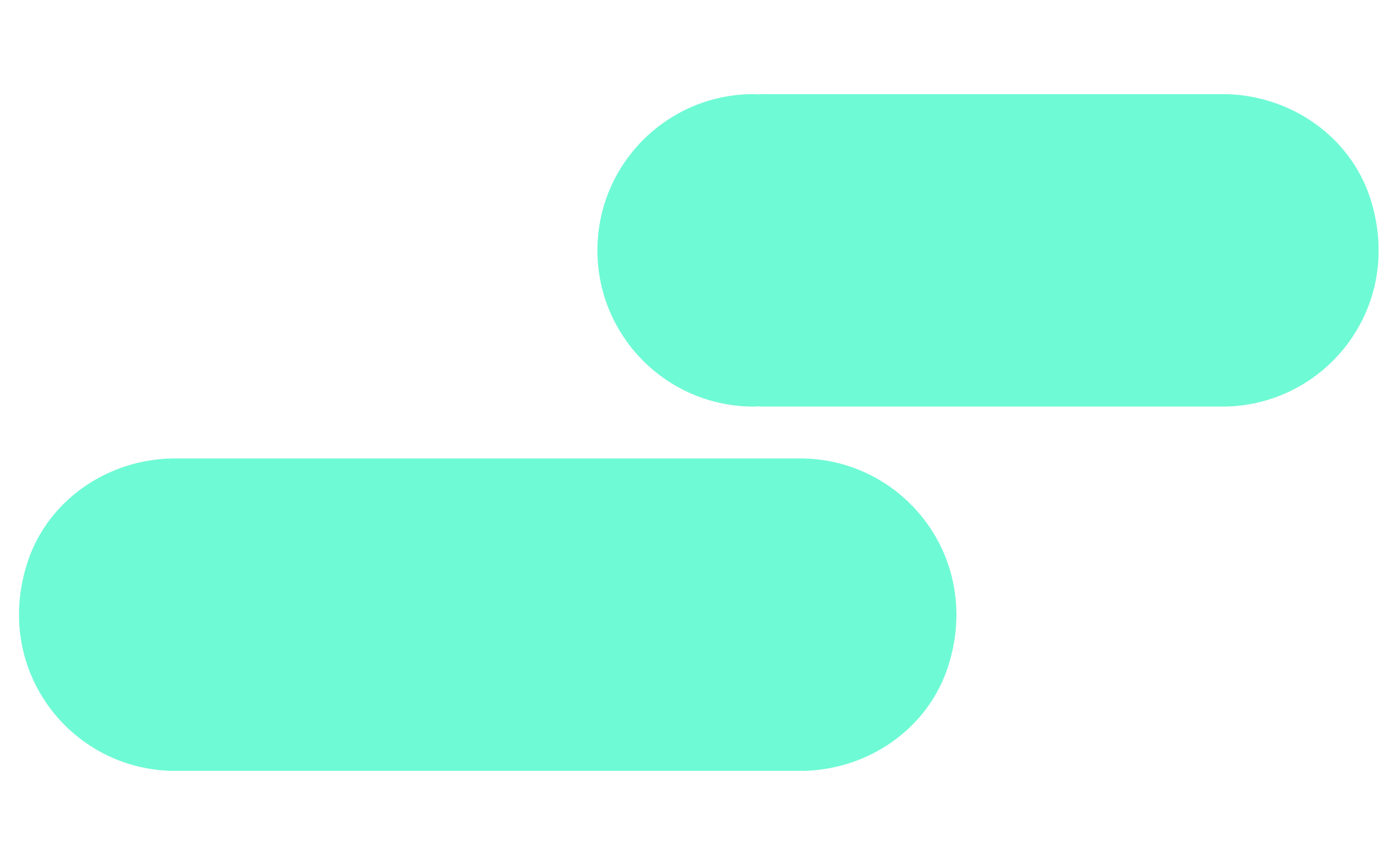Transparenz, gute Regierungsführung, Diversität und Chancengleichheit: Es sind Prinzipien, welche die Weltbank seit Jahrzehnten in dutzenden Entwicklungsländern einfordert. Bei der Besetzung des eigenen Chefpostens spielen diese hehren Grundsätze hingegen keine Rolle.
Vergangene Woche wurde der Amerikaner Jim Yong Kim als Weltbank-Präsident vorzeitig wiedergewählt. Er setzt damit eine Tradition fort, die wie ein Relikt des Kalten Krieges wirkt. Seit die weltgrösste Entwicklungsorganisation 1944 gegründet wurde, scheinen zwei Qualifikationen unstrittige Voraussetzung zu sein für die Belegung des einflussreichen Bank-Spitzenpostens: Alle zwölf bisherigen Weltbank-Präsidenten besassen den amerikanischen Pass – und alle waren Männer.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die USA rund drei Viertel des Weltbank-Budgets stemmte, war die amerikanische Führung noch erklärbar. Inzwischen aber ist die Bank längst zur global operierenden Organisation geworden. Sie zählt 189 Mitgliedsstaaten, hat Büros in 120 Ländern und ein 60-Milliarden-Dollar-Budget, zu dem die USA weniger als 20 Prozent beisteuern.
Das amerikanische Abonnement auf die Weltbank-Spitze geriet seit den 90er-Jahren denn auch zunehmend in die Kritik, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. 2011 wurden schliesslich neue Regeln zur leistungsbezogenen, offenen und transparenten Besetzung des Postens erlassen. Tatsächlich kandidierten ein Jahr später nebst Kim auch eine Nigerianerin sowie ein Kolumbianer fürs wichtigste Amt der Entwicklungsbranche – vorerst ohne Erfolg.
Trotz Kritik gesetzt
Diese Entwicklung versprach jedoch einen spannenden Wahlkampf für 2017, wenn Kims erste Amtszeit endet. Dies galt umso mehr, weil die bisherige Leistung des Sohnes südkoreanischer Einwanderer höchst umstritten war und er intern äusserst unbeliebt ist. Erst im August machte die Weltbank-Belegschaft mit einer unüblichen Massnahme gegen die Wiederwahl ihres Chefs mobil. In einem offenen Brief sprachen die Mitarbeitenden von einer „Führungskrise“ und wiesen auf die interne Unzufriedenheit, die mangelnde Transparenz bei der Besetzung des Chefpostens und die Dominanz der USA hin. Ihr Chef würde nicht anhand der üblichen Leistungskriterien gewählt, sondern in undurchsichtigen politischen Hinterzimmer-Deals bestimmt. „Die Welt hat sich verändert, auch wir müssen uns ändern. Sonst besteht das reale Risiko, auf internationaler Bühne ein Anachronismus zu werden.“
Bewirkt hat diese Kritik freilich nichts. Bis zur offiziellen Frist Mitte September hatten sich keine Gegenkandidaten gemeldet. Dabei sind sich viele Experten einig, dass der Gesundheitsspezialist und ehemalige Universitätsrektor bei einer offenen Ausschreibung kaum Chancen auf eine Wiederwahl hätte. „Sein Leistungsausweis würde hierfür nicht ausreichen“, meint etwa Paul Cadario, ein langjähriger Kadermitarbeiter der Bank.
Make the World Bank great again?
Dass Kim trotz interner Unzufriedenheit, fraglichem Leistungsausweis und Führungsschwäche weitermachen darf, ist ein rein politischer Entscheid. Obwohl die Weltbank in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, bleibt sie die mächtigste Entwicklungsorganisation der Welt. Ihr Budget ist gleich gross wie der gesamte Schweizer Bundeshaushalt – oder wie die 20 kleinsten Volkswirtschaften Afrikas. In Entwicklungsländern ist die Bank noch immer eine wichtige Investorin und eine einflussreiche Stimme. Die USA wird ihren Führungsposten deshalb nicht kampflos aufgeben.
Politik und Macht vor Leistung und Qualifikation: Dieses Schema lässt sich auch am Timing der Wiederwahl des Weltbank-Präsidenten erkennen. Obwohl Kims Amtszeit erst Mitte 2017 endet, wollte der Exekutivrat die Personalie bis spätestens zur Weltbank-Jahrestagung Anfang Oktober regeln. Grund für das hastige Vorgehen sind die Wahlen in den USA im November. Kim wurde von Obama berufen (und ist sein regelmässiger Golfpartner); mit einer vorzeitigen Wiederwahl können die Demokraten vermeiden, dass die Wahl in die Hände einer möglichen Trump-Regierung fällt.
Atlantischer Tauschhandel
Dass sich die Europäer nicht gegen solche Machtspiele der USA auflehnen, hat einen einfachen Grund: Während die USA traditionellerweise den Weltbank-Spitzenposten belegen, stellen die Europäer der informellen Regelung zufolge seit jeher den Chef des Internationalen Währungsfonds.
Dass jedoch auch die gewichtigen Schwellenländer China, Indien oder Brasilien keinen Gegenkandidaten stellen, hat auch mit einem gewissen Desinteresse zu tun. Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) haben 2014 – auch infolge ihres geringen Einflusses in der Weltbank – die „New Development Bank“ gegründet, China hat unlängst die „Asian Infrastructure Investment Bank“ etabliert. Damit verfügen diese Länder nun über Institutionen, mit denen sie Entwicklungsprogramme nach eigenen Regeln aufgleisen können.
Für die ärmsten Bevölkerungsschichten in Entwicklungsländern, deren Wohl an sich im Zentrum der Entwicklungsbanken stünde, sind dies keine guten Neuigkeiten. Die zunehmende Politisierung und Fragmentierung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit dürfte ihnen kaum zugutekommen. Wenn Entwicklungsbanken als geopolitische Vehikel missbraucht werden und die kurzfristigen Machtinteressen der Geberstaaten über dem Wohl der Empfängerländer stehen, werden Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit ad absurdum geführt.